OCR Leon & Nina Dotan - http://ldn-knigi.lib.ru/Judaic-D.htm (10.2004)
Aus unserer Büchersammlung. Alle Rechte vorbehalten.
eMail: ldn-knigi@narod.ru (http://ldn-knigi.narod.ru)
Text mit Originalseitenummer, immer am Anfang der Seite - {5}
Unsere Bemerkungen - Schrift kleiner, kursiv (ldn-knigi)
Es ist evtl. notwendig folgende Kodierung zu wählen -
Westeuropäisch (Windows) oder Westeuropäisch (ISO).

![]()
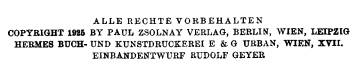
( ldn-knigi; zusätzlich, über dem Autor:
Quelle: http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.s/s028833.htm
Salten, Felix
(eigentlich Siegmund Salzmann)
Salten, Felix (eigentlich Siegmund Salzmann), * 6. 9. 1869 Budapest (Ungarn), Š 8. 10. 1945 Zürich (Schweiz)
Schriftsteller, Feuilletonist und Burgtheater-Kritiker. Gehörte zum Kreis des "Jung-Wien"; 1927-33 Präsident des Österreichischen P. E. N.-Clubs; emigrierte 1939 in die Schweiz.
Salten beeinflußte mit "Bambi" (1923, von W. Disney 1942 verfilmt) wesentlich die moderne Tiererzählung und gilt als Autor des Wiener Dirnenromans "Josefine Mutzenbacher" (1906).
Weitere Werke: Romane: Herr Wenzel auf Rehberg und sein Knecht Kaspar Dinckel, 1907; Olga Frohgemuth, 1910; Martin Overbeck, 1927. - Tierromane: 15 Hasen, 1929; Florian. Das Pferd des Kaisers, 1933; Bambis Kinder, 1940; Djibi, das Kätzchen, 1945. - Essays: Wurstelprater, 1911; Das Burgtheater, 1922. - Ausgabe: Gesammelte Werke in Einzelausgaben, 6 Bände, 1928-32.
Literatur: L. Pouh, Wiener Literatur und Psychoanalyse: Felix Dörmann, Jakob Julius David und F. Salten, 1997; Österreichisches Biographisches Lexikon.
Quelle: http://www.sbg.ac.at/lwm/frei/generated/a13.html
Felix Salten
1869-09-06 [Pest (Ungarn, A)\Budapest (H)] bis 1945-10-08 [Zürich (CH)]
Der Sohn eines ungarischen Ingenieurs, unter dem Namen Siegmund Salzmann in Pest geboren, entstammte einer langen Reihe von Rabbinern und übersiedelte knapp nach seiner Geburt nach Wien. Wegen der Schulden seines Vaters musste er schon von Kindheit an für die Familie sorgen und das Gymnasium früh verlassen, um bei der Phönix-Versicherung zu arbeiten. Nebenbei schrieb er unter dem Pseudonym Felix Salten Kurzgeschichten und bei mehreren Zeitungen. Die langjährige Freundschaft mit Arthur Schnitzler war eher ambivalent und problematisch, auch durch den "Austausch" von Geliebten.
1896 übernahm S. nach Theodor Herzl die Stelle des Feuilletonchefs bei der Wiener Allgemeinen Zeitung. Ab etwa 1900 war er bei allen wichtigsten Zeitungen in Österreich und Deutschland tätig. Er unterzeichnete seine Artikel mit den Pseudonymen Sascha, Martin Finder, u. a. Seine Feuilletons umfaßten wirklich fast alle Themenbereiche: bildende Kunst, Politik, Theateraufführungen u.a.
S. setzte sich v.a. für die Literaten Schnitzler und Hofmannsthal und den Maler Gustav Klimt ein. Seine Kunstkritik konkurrierte mit der Karl Kraus?. Die problematische Beziehung zwischen Kraus und S. wurde nicht nur durch den Zeitungskrieg, sondern auch durch Ohrfeigen im Café Griensteidl zum öffentlichen Problem.
Obwohl sein Hauptfeld Journalismus war, schrieb er gleichzeitig Prosa, (fast jedes Jahr gab er ein Buch heraus), Theaterstücke, Operettenlibretti (unter dem Pseudonym Ferdinand Stollberg schrieb er für Johann Strauß Sohn und Oscar Strauß), politische Essays; in Zusammenarbeit mit anderen Autoren verfasste er Drehbücher zu Ton- und Stummfilmen. Zu seiner Zeit hat er auch als Regisseur eine blendende Karriere gemacht. Trotz seiner Kritik an Adeligen und Abgeordneten und seiner Antipathie gegen Deutschland war er aber literarisch apolitisch.
Weltberühmt wurde er durch zwei Romane: Bambi (1923) und Josephine Mutzenbacher (1906); höchst ironisch, dass dieser Tierroman eher durch Walt Disney bekannt wurde, der die Bambi-Rechte Ende der 30-Jahre von S. für nur 5.000 US $ kaufte, als sich der als verarmter Flüchtling in Zürich befand. Nach dem Bambi-Erfolg wollten die Verlage von S. nur noch Tiergeschichten.
Tiefst davon überzeugt, dass die Kunst doch etwas mit Sinnlichkeit zu tun hat, ließ er anonym im Privatdruck im Wiener Verlag den Roman einer Wiener Dirne Josephine Mutzenbacher erscheinen. Das Buch wurde wegen Pornographie verboten und Schnitzler als vermutlicher Autor angesehen. Die Ergebnisse der Forschung haben inzwischen bewiesen, dass S. der wirkliche Autor war.
1938 emigrierte er in die Schweiz. Durch den erzwungenen Aufenthalt außerhalb des geliebten Wien wurde er zum gebrochenen, zurückgezogenen Mann. Er erlebte noch das Ende des Krieges und starb mit 76 im Oktober 1945.
Quelle: http://www.freud-biographik.de/salten.htm
Christfried Tögel und Liselotte Pouh
'Sigmund Freud, Felix Salten und Karl Lueger. Ein neuentdeckter Brief Sigmund Freuds'
Semmering 20.9.26 [1]
PROF. DR. FREUD WIEN IX., BERGGASSE 19
Hochgeehrter Herr
Nachdem ich Sie im Cottage-Sanatorium kennengelernt habe, nehme ich mir die Freiheit, ein persönliches Bedürfnis von mir durch diese Zeilen zu befriedigen. Es drängt mich, Ihnen meine Bewunderung für Ihren Luegerartikel in der N.Presse auszudrücken. (Sie sehen ich fühle mich als "Bürger von Wien") [2] Die heikle Aufgabe konnte kaum taktvoller, würdiger und - wahrheitsgemäßer gelöst werden.
In vorzügl. Hochachtung
Ihr Freud
Aus diesem Brief erfahren wir erst einmal, daß Freud und Felix Salten sich persönlich kannten. Sie hatten sich zuerst im Cottage-Sanatorium getroffen.
Freud hatte Mitte Februar 1926 mehrere Anfälle von Angina pectoris auf der Straße und konsultierte deswegen seinen Freund, den Kardiologen Ludwig Braun. [3] Braun und der auch hinzugezogenen Lajos Levy bestanden auf einem längeren Sanatoriumsaufenthalt Freuds. [4] Vom 5. März bis 2. April unterzog Freud sich dann im Cottage-Sanatorium in der Sternwartenstraße 74 (Döbling, XIX. Bezirk) einer "Herztherapie". Während dieser Wochen besuchte ihn dort u.a. auch Arthur Schnitzler. [5] Wir wissen bisher nicht, ob Felix Salten auch nur gekommen war, um Freud zu besuchen oder ob er sich vielleicht selbst einer Behandlung im Sanatorium unterzog.
Felix Salten hatte im Jahre 1910 ein Essay über Lueger veröffentlicht. [6] Sechzehn Jahre später und ein halbes Jahr nach der ersten Begegnung mit Freud [7] veröffentlichte Salten in der Neuen Freien Presse einen weiteren Artikel über den Wiener Bürgermeister [8]; die Identifizierung des Artikels verdanken wir Helmut Pouh, dem wir an dieser Stelle herzlich danken möchten. (Aus Anlaß der Enthüllung eines Lueger-Denkmals am 19. September 1926. [9] )
Schon einen Tag später schrieb Freud ihm daraufhin den oben abgedruckten Brief. Was mag Freud bewogen haben, so schnell zu reagieren und Saltens Artikel die Attribute "taktvoll", "würdig" und "wahrheitsgemäß" zu verleihen?
Zuerst ein paar Bemerkungen zur Vorgeschichte: Freud war - wie fast alle Wiener Juden - seit Beginn von Luegers politischer Karriere ein dezidierter Kritiker von dessen gesamtpolitischer Ausrichtung. Das illustriert z.B. folgende Episode:
Obwohl Karl Lueger am 29. Oktober 1895 vom Wiener Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt worden war lehnte Kaiser Franz Joseph I. dessen Ernennung ab, weil er eine zu stark antisemitisch orientierte Politik vertrat. [10] Aus Anlaß dieser Ablehnung durch den Kaiser erwähnt Freud zum ersten Mal Luegers Namen. An Wilhelm Fließ schreibt er über die Einhaltung des von dem Freund verhängten Rauchverbot:
Ich halte mich sonst an die Vorschrift, nur am Tage von Luegers Nichtbestätigung habe ich aus Freude exzediert. [11]
Die nächste Erwähnung Luegers erfolgt zweieinhalb Jahre später. Freud macht über Ostern 1898 (8. bis 11. April) mit seinem Bruder Alexander einen Ausflug nach Aquileja und Grado und besichtigt auf dem Rückweg die Höhlen von St. Canzian. [12] Die Beschreibung der Höhlen beendet Freud mit dem Satz:
Der Herr von Wien, Herr Dr. Carl Lueger, war mit uns gleichzeitig in der Höhle, die uns alle nach 3 1/2 Stunden wieder ans Licht spie. [13]
Freud enthält sich hier jeder Kritik, doch aus einem anderen Brief wird deutlich, daß seine Meinung über Lueger immer noch alles andere als günstig war. Bei einem Besuch bei Oskar Rie lernte Freud einen Bekannten von Wilhelm Fließ kennen; der Mann gefiel ihm sehr, forderte aber "durch sein tolerantes Urteil über unseren Lueger unseren Zorn heraus." [14]
Diese Zeilen sind ein Jahr nach Lueger Amtsantritt geschrieben worden. In den folgenden 12 Jahren bis zu seinem Tod im Jahre 1910 haben viele Wiener, darunter auch viele Juden, ihre Kritik an Lueger abgeschwächt. Seine Verdienste um Wien konnte niemand übersehen. Und aus dem Abstand von mehr als anderthalb Jahrzehnten - Freuds Brief ist aus dem Jahre 1926 - begann Lueger langsam zu einer Person der Geschichte zu werden.
An Saltens Artikel hat Freud wohl in erster Linie die Größe beeindruckt, mit der der Schriftsteller und Jude den Antisemiten Lueger beurteilte:
In den letzten Dezennien des alten Österreichs die repräsentativste Gestalt. Das kann man wohl sagen, selbst wenn man gar keine Ursache hatte, sich seinen Freund oder seinen Verehrer zu nennen. [15]
Hierauf mag sich Freuds Urteil "würdig" beziehen; damit anerkennt Freud die objektive Einschätzung Luegers durch den politisch andersdenkenden Salten. Eher "`taktvoll"' ist die folgende Passage:
Er hat die Ärzte und die Professoren und die Bildung und die Juden wohl kaum in Wahrheit gehaßt. Er war ein echter Wiener Kleinbürger, das heißt also, er war kein richtiger Hasser, nur ein rechter Schimpfer. [16]
Und schließlich ist der ganze Essay "wahrheitsgemäß", d.h. Salten entwirft ein Bild von Lueger, das facettenreich ist, nicht durch bestimmte Vorurteile beeinflußt wird und den Menschen Lueger in seiner Ganzheit charakterisiert. Einige Kernsätze aus Saltens Essay seien hier zitiert:
Er war sicherlich kein großer Mensch, doch ebenso gewiß bleibt es, daß er ein voller und echter Mensch war wie sehr wenige. Auch seiner Politik ermangelte die Größe, ihr fehlte der weite Horizont: sie blieb niederösterreichisch, wienerisch, blieb an Stadt und Gelände rund um den Stephansturm gebunden ...
Er war ein fabelhaftes Temperament, ein Menschenfänger ohnegleichen, ein genialischer Schauspieler und eine prachtvolle Natur. Auch die Gegner vermochten es kaum, sich dem Reiz seiner Persönlichkeit zu entziehen. Das war die Kraft des Liebenswürdigen, des Sinnlichen, des Lebensfreudigen, des Musikalischen, kurz des Wienerischen an Lueger. [17]
Freuds Brief an Salten und sein Lob des Essays zeugt von einem - trotz aller Ambivalenz Wien und Lueger gegenüber - Interesse an der Geschichte der Stadt, in der der Begründer der Psychoanalyse fast 80 Jahre lang gelebt hat. Und Lueger war immerhin 15 Jahre deren Bürgermeister.
(Noch über Wien, Juden, Lueger - siehe bei uns: Hans Tietze 'Die Juden Wiens' Geschichte-Wirtschaft-Kultur; Wien 1933; Dr. Joseph Samuel Bloch 'Erinnerungen aus meinem Leben' Wien 1922; Band 1; ldn-knigi) http://ldn-knigi.lib.ru/Judaic-D.htm
Anmerkungen
[1] Freud verbrachte die Zeit vom 17. Juni bis 27. September in der Villa Schüler am Semmering.
[2] Diese Klammerbemerkung kann sich sowohl darauf beziehen, daß er seit 1908 das "`Heimat- und Bürgerrecht der Stadt Wien"' besaß, als auch auf die Verleihung des Ehrentitels "`Bürger der Stadt Wien"' am 15. April 1924; vgl. Arbeiter-Zeitung vom 7.5.1924.
[3] Freud/Ferenczi Briefwechsel ÖNB, Autogr. 1053/45-4.
[4] Freud/Ferenczi Briefwechsel ÖNB, Autogr. 1053/45-6; Freud (1993e), S. 596.
[5] Freud (1955b), S. 99f.; Freud/Ferenczi Briefwechsel ÖNB, Autogr. 1053/45-6, 1053/45-7.}
[6] Salten (1910).
[7] Vermutlich trafen sich Freud und Salten noch ein weiteres Mal am 16. August 1930; vgl. Molnar (1992), S. 79.
[8] Salten (1926)
[9] Das Denkmal stammte von Josef Müllner und war bereits seit zehn Jahren fertig. Aber erst 1926 konnte ein geeigneter Standort gefunden werden:
Der heutige Dr.-Karl-Lueger-Platz am Stubenring.
[10] Lueger wurde erst nach der vierten Wahl zum Bürgermeister am 20. April 1897 vom Kaiser offiziell ernannt; vgl. Stadtchronik Wien. Wien/München: Brandtsätter 1986, S. 356.
[11] Freud (1985c), S. 153.
[12] Vgl. dazu Tögel (1989), S. 115-119.
[13] Freud (1985c), S. 338.
[14] Freud (1985c), S. 385.
[15] Salten (1926), S. 1.
[16] Salten (1926), S. 1.
[17] Salten (1926), S. 2.
6.10.1955: Felix Salten zum Gedenken
Quelle: http://www.wien.gv.at/ma53/45jahre/1955/1055.htm
Auf den 8. Oktober fällt der 10. Todestag des Schriftstellers Felix Salten.
Am 6. September 1869 in Budapest geboren, kam er schon als Kind nach Wien und trat frühzeitig mit literarischen Versuchen hervor.
1906 wurde er Leiter des Kulturteiles der "Neuen Freien Presse", für die er nahezu 30 Jahre arbeitete. Nach der Gründung des PEN-Clubs wurde er dessen Präsident, musste aber Österreich 1938 verlassen und wandte sich nach New York. Sein Wunsch, die Heimat wieder zu sehen, ging nicht mehr in Erfüllung, da er auf der Rückreise in Zürich starb.
Felix Salten hat ein sehr umfangreiches Lebenswerk geschaffen. An erster Stelle steht die Tätigkeit des Kritikers, Essayisten und Feuilletonisten. Den größten Erfolg erzielten jedoch seine Prosaerzählungen.
Seine Tiergeschichten, vor allem "Bambi", haben ihn in der ganzen Welt bekannt gemacht.... ldn-knigi)
Felix Salten 'Neue Menschen auf alter Erde'
{7}
I.
Man muß durch die Wüste, um von Ägypten nach Palästina zu gelangen, von Afrika nach Asien. Man muß fort von dem penetranten Grün der Fluren, die der Nil durchströmt, muß hinaus in die wundersame Öde. Weg von der unaufhörlichen, saftigen Frucht-barkeit, weg von den üppig getränkten, fetten Acker-flächen, die bukolisch belebt sind, hin durch die herr-liche Strenge der gelben Sandwellen.
Nirgendwo ist die Erde so ganz und so vollkommen sie selbst, wie in der Wüste. Weder auf dem Meer, noch auf den Gletschergipfeln des Hochgebirges wirkt sie so einsam, so erhaben, als Erdball.
Nicht Wohnstätte, nicht Pflanzung, nichts was mit Zweck oder Nutzen verwandt ist, verwirrt hier den Blick. Das alles wird dem Bewußtsein gering; hier in der Wüste erscheint Wuchs der Felder, Walddickicht nur wie Flechte, die den Riesenleib dieser Kugel da und dort bedeckt, unwichtig, klein, nebensächlich. Und das Treiben der Menschen ist so winzig, wie das Ge-wühl von Maden. Niederschmetternd bis zum Gefühl letzter Nichtigkeit ist der Eindruck, den die Wüste bietet und zugleich erhebend bis zur Ahnung des Gött-lichen. Ja, hier liegt die Erde ausgebreitet, die Erde an {8} sich. Ihr nackter Leib, den Menschenhände mit aller Arbeit nicht verändern können, ist seidig feiner Sand, weich schimmernd in allen Tönen, die das Gelb von der Ockerfarbe bis zum Kupferrot immer nur mischen kann. Da sind runde Hügel und flachgehöhlte Täler, vom Wind geschichtet und angewühlt, vom nächsten Sturm wieder zerblasen und in neue Formen geteilt, die doch wieder ewig dieselben bleiben. Was man da von einer, mühsam im rieselnden, rutschen-den Sandgerinne erklommenen Anhöhe überschaut, Welle an Welle, ins Unendliche, gleicht der Beweg-lichkeit einer See, die, einst von Orkanen gepeitscht, nun erstarrt ist. Es gleicht der Formation eines Ge-stirnes, das nach der letzten Feuerkatastrophe seiner Vulkane, nun zur Ruhe kam. Hier waltet, feierlicher, größer, ein anderer Sinn, ein anderer Rhythmus als derjenige, der kurzatmig und zappelnd unser Leben bewegt. Hier ist, beinahe, Mondlandschaft, ist voll-kommen, wie nirgendwo: Erdlandschaft.
Das war der Weg, den Moses die Juden geführt hat, fort aus Mizrajim, dem Lande der Knechtschaft, in das Land der Verheißung. (Mizrajim - Ägypten; ldn-knigi)
Armes Volk, das diesen harten, einsamen Weg der Befreiung gegangen ist; ausgeschieden und ausge-trieben aus den Gefilden des Reichtums, aus den Fluren des Genießens, aus der guten Stallwärme be-ständig ruhigen Wohnens. Armes Volk, das ganz allein war mit sich und seinem strengen Gott, um-geben von der drohenden Strenge der Wüste und dazu noch gestriemt von den Erinnerungen an die stets {9} gefüllten Futternäpfe. Denn die Heimat, der sie su-chend entgegenwanderten, kannten sie nicht mehr, und das Land, von dem sie ausgezogen waren, hatten sie noch nicht vergessen.
Als sie Ägypten verließen, im ersten Rausch der Freiheit, im Triumph über ihre Peiniger, im Taumel ihrer neu errungenen Rechte, aßen sie das Brot un-gesäuert und achteten die Kargheit ihrer Speise für weniger, als ein kleines Opfer. Sie hätten, wie jedes Volk, in den Tagen der Erhebung und der Erregung bereitwillig auch Hobelspäne geschluckt oder Stroh gekaut. Aber dann, draußen in der Wüste, allein in der großartigen öde, allein mit ihrem Gott, den sie nicht schauen konnten und den sie nicht beim Namen nennen durften, preisgegeben dem Befehl eines Füh-rers, dessen Tyrannei sie verschüchterte, dessen Ab-sichten sie nur halb begriffen, dessen majestätische Hoheit sie kaum ahnten, brach ihre Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens ungestüm hervor.
Es war, damals schon, jenes wurzellose Heimweh, das die Juden so oft um einer Heimat willen gelitten haben, die nicht die ihre gewesen und die ihnen nur Mißhandlung geboten hatte.
Wie verängstigt und erschrocken mag das Volk am Fuß des Sinai hingesunken sein, vor dreitausend Jahren, als Gott sich in Gewitterwolken zum Gipfel des Berges niederließ. Der Sinai steht heute noch genau so da wie einst. Nichts ist verändert, alles wie damals und die dreitausend Jahre scheinen in seinem Anblick wie ein Tag. Er gleicht seinen geringeren {10} Vettern, der Sinai, den anderen Felsgebirgen, die sich hier oft aus der Wüste erheben, dem Mokkatam bei Kairo oder den Steinwänden vor Theben, in denen die Ägypter ihre Pharaonen begruben; er gleicht ihnen in den rötlichen und fahlgelben Farben seiner Mauern und in der toten Zerrissenheit seines Bodens. Nur mächtiger ist er, als seine übrigen, kleinbürger-lichen Verwandten hierzulande. Er reckt sich empor, wie das Haupt eines riesenhaften Löwen; er steht da, wie die unbarmherzige Drohung eines Giganten, und er ist in das Antlitz der Erde hier gezeichnet, wie das Stirnrunzeln einer zürnenden Gottheit. Gewaltiger als alle Gebirgsgipfel der Welt ist der Sinai, denn auf seinem Rücken hat er Gott getragen, indessen die an-deren Bergspitzen auf ihrem Haupt und an ihren Schultern nur Schnee liegen haben, den jede Sommer-sonne zu schmelzen, den jede Wolke wieder zu er-neuern vermag. Die Gegenwart Jehovas aber ist vom Sinai nicht mehr zu tilgen und die Lawine des gött-lichen Wortes, die damals niederdonnerte, haben die Sonnen dreier Jahrtausende nicht hinwegschmelzen können; ihre Spur wird aus den Herzen der Menschen in zehnmal drei Jahrtausenden nicht zu löschen sein und frisch bleiben, wie am ersten Tag.
Herrlicheren Reichtum, als je aus quelldurchrauschtem Felsenhang sprudelte, oder aus goldge-ädertem Bergesschoß gegraben wurde, hat diese stei-nerne Anhöhe der Welt geschenkt. Denn in der knapp gemeißelten Form der Zehn Gebote ist der Inhalt und der Weg, die Weisheit und das Glück der Seele {11} beschlössen, ihre Stütze und ihre Ruhe, ihre Fülle und ihre Unsterblichkeit.
Ein neues sittliches Bewußtsein erwachte, loderte empor, war noch klein und noch nicht weithin sicht-bar, war noch genau so unbekannt, wie die Flammen des brennenden Dornbuschs, aber ebenso rein, ebenso unwiderstehlich wie diese. Alle die Gottheiten und Götzen Ägyptens wurden von diesem Feuer zu Asche vernichtet; ausgetilgt wurden die Fetische der Phili-ster und Amalekiter, die mächtigen Dämonen der mächtigen Perser und Assyrer. Selbst die schönen, da-seinsfreudigen Götter Griechenlands verbrannten zu Asche. Ihre prächtigen Tempel, ihre Bildsäulen und Altäre wurden Ruinen und Trümmer und der Welt blieb nichts, als jener brennende Dornbusch, den das Feuer nicht verzehrte, blieb nichts als dieser Berg in der Wüste hier, der ein einzigesmal zum Schemel für Jehovas Füße gedient hatte.
Das Volk, das damals hier erschrocken auf sein An-gesicht fiel, war von der Sorge um das tägliche Brot zu sehr gequält, von der Sehnsucht nach dem Land, darin Milch und Honig fließt, zu arg zerwühlt, um zu verstehen, was an seinem Erlebnis erhaben war und ins Ewige reichend. Sie ahnten nur, ganz leise, tief im Dämmern ihres tiefsten Innern, daß sie aus-erwählt seien. Aber, wenn die andächtige Beklem-mung des Augenblicks sich wieder löste, empfanden sie nichts, als daß sie gepeinigt wurden, daß Leiden ihr Teil blieb, daß ihnen ein fernes, ein unendlich fernes Ziel gesetzt war und daß sie ihr Leben dran geben mußten, {12} um dieses Zieles willen. Sie trugen das Los, das Aus-erwählte immer tragen, so lange die Welt steht: ge-peinigt werden, leiden und das Leben einem fernen Ziel zum Opfer bringen.
In der Wüste, die ich durchfahre, wandern Be-duinen. Sie kommen aus Ägypten und sind, wie ich, auf dem Weg nach Palästina. Ausgestreut im gelb-roten, sonneglühenden Sand, zieht ihre Schar lang-sam dahin. Sie reiten auf schönen, arabischen Pfer-den, die dünne Beine haben und kleine, zierliche Köpfe. Kamele führen sie mit, die ihre Zelte tragen, viele Esel, die stämmig sind, graue und weiße, die hochbepackt einhertrollen, oder auf denen die Frauen sitzen. Ihre Herden treiben sie mit, Schafe, Ziegen und kleine Rinder. Von den jungen Männern gehen manche zwischen dem Gewimmel zu Fuß und sie gehen in einem merkwürdigen, adelig sorglosen Schlenderschritt.
Aus den Geflügelkörben auf dem Rücken eines Kamels hat sich ein Huhn losgemacht, flattert zu Bo-den und rennt davon; erst langsamer, mit vornickendem Kopf und mit dem behutsam affektierten Zu-stechen der Beine; dann aber, gescheucht, läuft es ziel-los kreuz und quer, mit schlagenden Flügeln. Ein junger Kerl springt hinterdrein, will das Huhn fangen, das nun wie ein dunkles Pünktchen über den hellen Wüstenboden huscht. Drei, vier andere junge Männer eilen zu Hilfe. Es ist kein Spaß dabei, sondern wie ernste Arbeit. Man merkt an dieser Jagd, wie viele Löcher und Buckel, wie viele Spalten und Ritzen der {13} seidenglatte, schimmernde Sandboden hat. Und man versteht an der leidenschaftlichen Verfolgung, welchen Wert ein einziges Huhn für Menschen besitzt, die in der Wüste wandern müssen.
Die Beduinen ziehen, wie einst die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob gezogen sind, als Nomaden, mit ihren Kamelen und Pferden und Eseln, Schafen, Ziegen und Rindern. Nur wenig unterscheidet sich das Leben dieser Beduinen da von dem Leben unserer Patriarchen in grauer Vorzeit.
Diese Beduinen gehen die gleiche Richtung, in der die Juden einst auszogen, von Ägypten nach Palästina, vor dreitausend Jahren. Und alles ist hier unverändert, alles ist wie damals. Die Wüste, der schmale Silber-streif des Mittelmeeres, der in weiter Ferne manchmal aufglänzt, der hochgewölbte, saphirblaue Himmel, und die grelle, nackte Sonne, die ihre blendenden Strahlen wie Feuer niederschüttet. Alles, wie einst.
Die Beduinen werden zum lebendigen Traumbild einer längst dahingesunkenen, ungeheueren Vergan-genheit. Aber diese Beduinen, die von den Weidegrün-den des Fayoum kommen, marschieren ohne Hinder-nis, ohne Wunder und ohne Erscheinungen zu er-leben, und sie werden Halt machen, bis sie die Wiesen-flächen von Gaza erreicht haben. Sie legen diesen Weg in freier Entschließung Jahr für Jahr zurück und er dauert nur wenige Wochen. Ihr Zug weckt aber die Erinnerung an den Exodus der Juden, der eine große, gottbefohlene Tragödie gewesen ist.
{14} Sie haben sich aufgelehnt in der Wüste gegen ihren jähzornigen Gott, die armen Juden, die aus Ägypten kamen. In ihrer Bedrängnis entsannen sie sich der vielen kleinen, gefälligen Götterchen und Götzen am Nilufer, entsannen sich des gutmütigen Apis, der ein Rindvieh war, und wollten auch so einen Gott be-sitzen, den man sehen, den man mit Händen greifen konnte, mit dem man vertraulicher, bequemer um-gehen durfte. Damals geschah es, daß sie den Schmuck ihrer Frauen zu Aaron trugen. Dieser Mann, der bei all seiner Güte wankelmütig war und vielleicht auch ein wenig eifersüchtig auf den rätselhaft gebietenden Bruder, dieser Mann, der es zehnmal verdient hätte, davongejagt zu werden und der wohl nur durch seine im Grunde liebevolle Seele der Verdammnis immer wieder entging, formte aus all den Schmucksachen einen kleinen Vetter des Apis. Dann lief er, während die Juden um das goldene Kalb tanzten, Moses ent-gegen, und bat ihn mit reuigen Worten um Verzeihung. Gott aber erzürnte sich und sprach: 'Ich sehe, daß es ein halsstarriges Volk ist."
Er war, wie schon bemerkt, sehr jähzornig, dieser Gott, er ist es wahrscheinlich heute noch, und er ließ sich von seinen Zornanfällen oftmals viel weiter hin-reißen, als er wollte, so daß dann Moses ihn beschwichtigen und vom Äußersten zurückhalten mußte. Aber er hat die Eigenschaft, in seinem Zorn herrliche Wahrheiten auszusprechen. So gehört denn auch sein Ausspruch bei Gelegenheit des goldenen Kalbes, daß nämlich die Juden ein halsstarriges Volk sind, zu den {15} absoluten Wahrheiten und ist wahr geblieben bis auf diesen Tag.
Ach, es sind die besten und die treffendsten Dinge, die es jemals über das Judentum zu hören gab, gerade während jener Zeit der Wüstenwanderung gesagt wor-den. Das sind Aussprüche, so erschöpfend charak-teristisch, so tief, so meisterhaft psychologisch und so weit voraussehend, daß man kopfstehen könnte vor Staunen, wüßte man nicht, daß sie von Gott stammen und von Moses, die alle beide wie niemand sonst auf Erden die Juden gekannt haben, und von denen der eine eben Gott, der andere nur um ein Geringes weniger als Gott gewesen ist, nämlich Moses.
Aber die Juden wären nicht Menschen und, vor allem, sie wären nicht Juden gewesen, wenn sie nicht rebelliert hätten gegen ihren Gott und gegen ihren An-führer. Es ging ihnen oft erbärmlich genug. Nicht immer fiel Manna vom Himmel; nicht immer kamen Wachteln in Riesenschwärmen und nicht immer schlug Moses mit dem Stab an den Felsen, daß klares Wasser hervorsprang. Da gab es Männer, die der festen Meinung waren, sie könnten das Volk besser führen als Moses. Solche Männer hat es immer wieder in Israel gegeben und sie vermögen es immer wieder, Unheil anzurichten, denn Gott mengt sich nicht mehr ein, wie damals, da er den Korah und seine Rotte vom Erdboden vertilgte. (Korah: zugellose Horde [nach einem Enkel Levis, der mit seinen Anhängern gegen Moses einem Aufruhr anstiftete u. vom Feuer verzehrt wurde]; ldn-knigi)
Auch die Frauen trugen mit ihrer Klatschmäuligkeit das ihrige dazu bei, Gott und dem Propheten das Leben zu erschweren und zu ver-bittern. Der wackere Aaron, der immer nur dann ganz {16} zuverlässig war, wenn ihm die eherne Hand des Moses auf der Schulter lag oder wenn er vor den Feueraugen des großen Bruders den Blick zu Boden senken mußte, Aaron also hatte das Schicksal, neben einem Genie zu stehen, wie Lucian Buonaparte etwa neben Napoleon stand, und Aaron besaß in Mirjam ein braves, ein begeistertes Weib, das aber manchmal vor Neid und Ehrgeiz verging. Sie wäre mit ihrer Frage: Warum Moses und nicht du? beinahe drauf und dran gewesen, einen bösartigen Bruderzwist zu entfesseln. Doch Gott schlug Mirjam und eine Woche lang bedeckte der Schnee des Aussatzes ihr Antlitz, so daß sie sechs Tage lang abgesondert interniert werden mußte, in welcher Frist ihr die Lust verging, Streitigkeiten anzuzetteln, und die Brüder sich wieder vertrugen.
Was auch vorfiel in dieser langen Zeit an Unge-horsam, Widerstand, Kleinmut oder Verzweiflung, es ist menschlich, gemessen an dem trostlosen Dasein in der Wüste, gemessen an der Not, die Leib wie Seele litt, an dem hart geprüften Hoffen. Und das Ausharren der Kinder Israels über alle die schweren Heimsuchungen hinweg, die stille Zähigkeit, mit der sie ihr Schicksal trugen, die unüberwindliche Kraft des Leidens, ihre grenzenlose Bereitschaft, sich zu opfern, Brücke zu sein, Wegzeichen und Straßenstaub für die Kommenden, dies alles ist erstmalig in der Welt gewesen und jüdisch. Erstmalig in der Welt war auch dies inbrünstige Han-gen am Gedanken des einzigen, unsichtbaren Gottes, zu dem sie von allen augenblicklichen Versuchungen {17} immer wieder heimfanden. Diesem Volk, das zwischen üppig fruchtbaren Ländern durch Wüstenöde in der Irre umherzog, war der einzige, unsichtbare, unnenn-bare Gott Heimat und Wurzelerde. Sie haben die vielen kleinen Götterchen und Götzen Ägyptens aus der Tiefe ihres Blutes verachtet. Sie sind arm gewesen, aber stark; mitleidswürdig, aber heroisch; rebellisch aber dennoch treu; zerstritten und zerzankt unterein-ander, aber eins und einig in allen großen Stunden. Sie sind begierig gewesen nach Wohlleben und Reich-tum, trotzdem waren sie jedesmal bereit, alle Kostbar-keiten der Erde von sich zu werfen für die Schätze des Geistes. Und sie geben ein Beispiel damit bis heute. Denn sie sind sich gleichgeblieben in jedem Ägypten, dessen Mißhandlungen sie zu dulden hatten und auf allen Wüstenwanderungen, zu denen sie gezwungen waren bis auf diesen Tag.
Hier, auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land, mitten in der strahlenden Öde, die so beredsam ist und so belebt von großen Erinnerungen, hier wo ich gleich weit entfernt bin von den Ufern des Nils wie von den Fluren des Jordans, neige ich mich stumm vor dem Gott meiner Väter. Hier bin ich ganz allein mit ihm, wie niemals zuvor. Er war ein Fremdling da-mals auf Erden, unbekannt, nur wenig geachtet von den Völkern der Welt, von ihren Königen, Feldherren und Priestern. Aber er hat seit jenen Tagen eine un-geheure Karriere gemacht, die so einzig bleibt, wie er selbst einzig ist. Mit dem kleinen Volk, das er aus-erwählt hatte, zog er sich in die Wüste zurück und {18} bereitete den gewaltigsten Umsturz vor, den die Menschheit je erlebt hat. Dieses Volk aber ließ er arm und rechtlos und elend zurück, während er dann zum höchsten Triumph emporstieg.
Doch er bewahrte es vor Untergang, er hielt es le-bendig, kraftvoll und jung, indessen so viele andere, größere Völker vom Alter entkräftet hinsanken, starben und verschwanden. Sein Volk hat die Mission, die es in Ägypten, die es vom Sinai herab und hier in der Wüste empfing, weitergetragen in alle Lande.
Es ist ein Volk von Umstürzlern und Rebellen geblieben, bis in die Gegenwart, ein halsstarriges Volk. Arm und rechtlos streitet es für die Rechte der Freiheit, kämpft auf allen Schlachtfeldern und Barrikaden wider Pharao und ist nicht erschöpft durch die Ströme Blutes, die es im Lauf der Jahrtausende hingeschüttet hat, nicht gebeugt von den vielen Jochen und Ketten, die es tragen mußte, nicht geschwächt noch entmutigt von den Foltern, mit denen sein Leib wie seine Seele zerrissen wurde.
Waffenlos, hat dieses Volk seine machtvollsten Feinde, die sich Sieger wähnten, immer noch besiegt. Denn in ihm lebt die Idee des ewigen Gottes, in seinem Hirn und Herzen pocht unsterblich die Ewigkeit der Idee.
{19}
II
Der vornehme Herr in Kairo, mit dem ich manch-mal sprach, sagte: 'Es ist nichts los in Jerusalem." Was ich auch einwenden mochte, wie sehr ich auch in ihn drang, er blieb jedesmal dabei: 'In zwei Tagen sind Sie mit diesem Nest fertig, in fünf Tagen mit dem ganzen Land ... es ist nichts los in Palästina."
Er war sehr reich, dieser Herr, er hatte ausge-breitete und offenbar sehr einträgliche Geschäfte, aber er war trotzdem kein großer Kaufmann, denn ihm fehlte die Phantasie, ihm fehlte der Schwung und der Idealismus, ihm fehlte der Tropfen Künstlerblut, den ich immer noch bei großen Kaufleuten gespürt habe. Er war von einer eleganten Glätte, in seinen Manieren ebenso wie in seinem Wesen, doch er besaß keinen Funken Persönlichkeit und war eigentlich ein ganz unbedeutender Mensch. Deshalb sagte er, obwohl er unzähligemal dort geweilt hatte: 'Es ist nichts los in Jerusalem."
In der Folge unterhielt ich mich auch nur noch aus Höflichkeit über diese Dinge mit ihm. Aber hier erst, seit ich in Palästina bin, weiß ich, daß jener Mann zu den Leuten des ancien regime gehört, zu jenen Men-schen, deren Engstirnigkeit es überhaupt erst {20} verschuldet, daß ein Regime alt wird und vergeht. Er saß gesättigt, zufrieden und stolz vor den Fleischtöpfen Ägyptens. Sein innigster Seelenwunsch, daß dieser an-genehme Zustand ewig dauern möge, hatte sich längst in die feste Überzeugung gewandelt, es werde immer so bleiben. Darum hütete er sich ängstlich, wo anders und nun gar auf dem heiklen Boden Palästinas, neues Leben zu sehen, hatte eine geheime, ihm selbst nicht bewußte Angst, von diesem neuen Leben die geringste Kenntnis zu nehmen. Oh ja, es sitzen überall in der Welt, nicht bloß in Ägypten, satte, zufriedene und stolze Ju-den vor hochgefüllten Fleischtöpfen, und rühren sich nicht, weil sie, bewußt oder unbewußt, schreckliche Angst vor dem neuen Leben im uralten Lande haben, weil ein dunkler Schreck sie peinigt, sie könnten ihre eigenen Errungenschaften gefährden, wenn sie der Arbeit für die Zukunft zu Hilfe kommen. Sie ahnen nicht, die Armseligen, wie sehr sie schon zum ancien regime gehören, sie ahnen nicht, daß sie nur um so gewisser versinken werden, je hartnäckiger sie sich an ihr gutes Leben klammern, je eigensinniger sie in ihrer Einstellung zur Welt beharren.
Gleich nach dem ersten Tage der Ankunft, habe ich Jerusalem wieder verlassen. Keineswegs weil nichts los war. Die Stadt ist mir zu stark gewesen für den ersten Tag des Anfangs. Ihr Name, dieser uralte heilige Name, brach wie ein Donnerklang in mir aus, jetzt, da er nicht bloß ein Name mehr war, sondern als Wirklichkeit vor mir lag. Dieser Name, der mit dem Brausen großer Orgeln in mir schulterte, verhängte {21} meinen Blick, so daß ich nicht wagte, Jerusalem an-zuschauen. Das Rauschen dieses Namens, darin alle Ereignisse der Bibel und der Geschichte wie unge-heuere Katarakte niederstürzten, verscheuchte den Schlaf von meinem Lager. Und am andern Morgen hin ich fort aus der physischen und seelischen Höhenluft von Jerusalem, bin abwärts gefahren durch die Berge von Judäa, hierher an den Meeresstrand, in die Stadt Tel Awiw, die ganz von Juden erbaut ist, die eine Er-oberung vorstellt, mehr noch: eine Leistung.
In den breiten, schnurgeraden Straßen von Tel Awiw lebt das Heute. Kein aufregender Schatten der Vergangenheit, nur der lebendige Puls dieser Gegen-wart. Biegt man auf der großen Avenue, die zum Strand führt, in eine der Nebengassen, so winken Häuser aus den Dünen. Ohne Trottoir, ohne rechten Weg stehen sie da, auf dem gelben Sandgrund der Dünen und sind eben erst fertig geworden. Sie sind das Morgen. Und weiter draußen, die vielen anderen Häuser, noch von Gerüsten umkleidet, noch im Bau begriffen, stellen das Übermorgen vor. Diese Stadt, in der es keine Vergangenheit gibt, hat nichts als das Heute, kaum ein Gestern, und sonst nur ein höher und größer anschwellendes Morgen und Übermorgen.
Kaum fünfzehn Jahre sind es her, seit hier die ersten Wohnstätten errichtet wurden, in naher Nachbarschaft der jüdischen Quartiere von Jaffa. Dann muß man vier Jahre des Weltkriegs abrechnen, während welcher Zeit nirgendwo gebaut und überall nur zerstört wurde. Dann aber kam ein Aufschwung, wie er im Orient {22} ohne Beispiel ist, ein Tempo, das oft amerikanisch ge-nannt wurde, das aber solch ein Prestissimo hat, daß man die Stadt buchstäblich wachsen sehen kann, wenn man auch nur ein paar Tage bleibt.
Tel Awiw wird, dereinst einmal, eine schöne Stadt sein, auch architektonisch. Vorläufig merkt man nur, daß die Erbauer der ersten Häuser zu große Eile hatten, um überhaupt nach Schönheit zu streben, oder daß sie die Schönheit in jener Richtung suchten, die man in Wien 'Sezession", in München 'Jugendstil" nennt. Die, neuen und neuesten Gebäude zeigen jedoch schon beträchtlichen Fortschritt. Man baut einfache Fassaden, deren Gliederung, deren Loggien und Bal-kons eine schmucklose, gleichsam natürlich gewach-sene Schönheitslinie haben und sich der Küstenland-schaft ruhig einfügen, statt ihr schreiend zu wider-sprechen.
Jugend ist das Berückende an dieser Stadt. Jugend, Arbeit und ein jugendlich stürmisches Aufstreben. Aus allen Teilen der Erde sind Juden hier zusammenge-strömt, aus dem Osten Europas, aus Indien, aus Ame-rika, aus dem Kapland und aus dem Yemen. Man spricht Englisch, Französisch, Deutsch, Jiddisch, auch Arabisch. Doch alle vereint die offizielle Umgangs-sprache: das Hebräische.
In den breiten Straßen sausen Automobile, gehen lastentragende Kamele, traben bepackte Esel, und rasche Autobusse besorgen den Verkehr nach Jaffa, das sie in etwa fünf Minuten erreichen. Tel Awiw be-sitzt Institute, die für ganz Palästina wichtig sind. Das {23} Herzl-Gymnasium in der Herzlstraße gilt als Muster-anstalt. Ferner ist eine Handelsschule da und eine Musikschule und außerdem eine landwirtschaftlich gerichtete zoologische Versuchsstation. Jetzt noch ein wenig außerhalb der Stadt, aber bald von ihr erreicht und umschlossen, liegt das Ruttenbergsche Elek-trizitätskraftwerk. Das Turbinengebäude ebenso wie das Beamtenhaus sind von monumentaler Schönheit.
Ein paar Jahre hat die nahe Nachbarstadt Jaffa von dem jüdischen elektrischen Licht nichts wissen wollen, dann aber die ablehnende Haltung aufgegeben, und jetzt wird die Leitung, die Jaffa mit Licht wie mit Kraft für eine Straßenbahn versieht, fertiggestellt. Man arbeitet eben daran, während ich hier bin.
Dieser Vorgang im Kleinen darf wohl für die ganze Entwicklung im Großen gedeutet werden. Die ara-bische Bevölkerung wird sich einige Jahre der Elek-trizität, mit der das Land von den Juden bildlich und wirklich durchströmt und durchzuckt ist, ablehnend gegenüberstellen. Doch der Tag muß kommen, da sich auch die Araber der gemeinsamen Leitung an-schließen, da sie sich der Kraft wie des Lichtes gerne bedienen, die von der jüdischen Aufbaubewegung
ausgeht.
Inzwischen gibt es noch trennende Gegensätze, Ab-neigung, ja sogar Feindseligkeiten auf beiden Seiten genug. Man sieht freilich Araber in den Straßen Tel Awiws; man sieht gruppenweise katholische Nonnen und Geistliche hier spazieren gehen und die Juden-stadt betrachten, die so grundverschieden ist von den {24} 'Judenstädten" im alten Europa. Sie schlendern hier umher und sehen die schönen Parks, sehen die Kinder-gärten, darinnen die Kleinen und ihre Pflegerinnen hebräische Lieder singen, sehen die Jungens auf freien Plätzen vor den Schulen ihre Turnübungen vollführen, in ausgezeichneter Disziplin, trotzdem die Lehrer in ihrem Verhalten zu den Kindern ganz kameradschaftlich sind.
Sie sehen den fleißigen Be-trieb in den Werkstätten, die Ordnung in allen Häu-sern und in allen Straßen. Es blitzt und blankt hier vor Sauberkeit, wie in irgendeiner Stadt Skandinaviens und nicht wie an der Südostküste des Mittelländischen Meeres. Das Staunen dieser Menschen ist ein Irrtum. Denn weil Juden so rein, so ordentlich, so einfach fleißig sind, staunen sie, statt sich beschämt zu wundern, was Gehässigkeit, grausame Unterdrückung in Europa aus diesem Volk gemacht haben, das man viele Jahr-hunderte lang in Wohnstätten gepfercht hielt, die für das Vieh zu schlecht wären, dem man alle Rechte nahm, sogar das Recht auf Arbeit.
Tel Awiw hat natürlich alle Rechte. Auch das Recht der autonomen Verwaltung. Und vom Bürger-meister an bis zum letzten Lastträger ist in diesen Mauern alles jüdisch. Die Polizisten, die Elektrizitäts-maschinisten, die Arbeiter am Wasserdienst. Alles. Selbstverständlich kann die Permanenz solcher Funk-tionen nie gestört und nie unterbrochen werden, auch nicht durch den Sabbath. Daß vom Freitag abend bis zum Samstag abend Christen oder Mohammedaner an die Stelle der sabbathfeiernden Juden treten, ist {25} ein Ghettobrauch gewesen. Er muß hier, wo es kein Ghetto mehr gibt, auch keines im Geiste oder in der Seele, notwendig verschwinden. Und so wie hier am Sabbath jede Arbeit ruht, die Ruhepausen verträgt, so tun alle ihren Dienst, der keine Unterbrechung duldet: die Polizei, die Männer, die an der Elektrizität, am Wasserwerk oder am Verkehr beschäftigt sind. Auch während des Sabbaths. Das lebendige Leben ist hier wieder einmal stärker gewesen als das starre Ge-bot. Ja, es ist in Palästina auf allen Wegen stärker.
Am Purimfest wogt eine nach Tausenden zählende Menschenmenge durch die Straßen. Denn Tel Awiw hat schon über dreißigtausend Einwohner. Geputzte Kinder, geschmückte junge Mädchen, festlich geklei-dete Jünglinge. Und der Flirt blüht. Man tanzt beim Fünfuhr-Tee zum Spiel einer kleinen Salonkapelle in dem hübschen Kasino am Meeresstrand Foxtrott und Shimmy. Man wird am Abend ein paar Bälle haben und Purimspiele. Sogar Araber sind aus Jaffa herüberge-kommen, um sich hier mit all den anderen zu ver-gnügen. Nachdem die Sonne herrlich ins Meer ge-sunken ist, strahlt die ganze Stadt im Lichtglanz der elektrischen Bogenlampen und Glühbirnen. Musik, Ge-sang, Lachen und Freude überall in der Menge, die unter diesem milden Himmel sich ergeht, die über-strömt ist von der salzigen Luft des Meeres und von dem betäubenden Duft der Orangenblüte, der aus den großen Gärten der Umgebung herüberweht. Aber mitten in der Nacht knallt ein Schuß, kaum gehört im Festklang, der die Straßen erfüllt, und ein Jüngling {26} liegt tot auf dem Pflaster. Es gibt nur eine einzige Meinung darüber: Araber! Niemand weiß, ob das ein momentaner Streit gewesen ist, oder das letzte Kapitel einer langen persönlichen Feindschaft, oder ob der junge Mensch einem planmäßigen Terrorakt als zu-fälliges Opfer fiel.
Tragödie des Anfangs.
{27}
III
Tage in Jaffa. Immer komme ich von Tel Awiw hierher, den Weg, auf dem die alte Stadt landeinwärts von ihrem Felsen steigt, um sich in Parks, in Boule-vards, deren Mitte Gartenanlagen schmücken, zu er-neuern. Aber der Eindruck Geschäftsviertel, Quartier der Spediteure, dieser vorstädtische, kleinstädtische Eindruck bleibt auch hier, im jungen Teil von Jaffa, trotz der Versuche zur Eleganz, trotz der Anläufe zu festlicher Geschmücktheit. Diese Anläufe sind, wie fast überall im Süden und besonders im Orient, bald schlapp geworden, muten an, wie verstaubt und ver-gessen, und stimmen eher traurig als festlich. Sie kön-nen meist nur den einzelnen Tag, meist nur die gegen-wärtige Stunde feiern, die Kinder der südlichen Sonne. Dann flammt die Festlichkeit in ihren Städten auf als ein herrlicher Brand von Farben und Pracht, dann tritt die wildkühne Phantasie, tritt das Märchen leben-dig geworden in die Wirklichkeit, die davon wunderbar erglüht und bis ins Zügellose berauscht wird. Die Menschen sind dann wie außer sich geraten. Es ist un-möglich, sich dieser Glut und diesem Rausch zu ent-ziehen. Man wird hingerissen, wie man nur in die {28} Nähe eines solchen Taifuns freudig erregter Volks-leidenschaft gelangt.
Jetzt aber ist Alltag in Jaffa. Unaufhörlich durch-wandern die langen Züge von Kamelen, eines hinter dem anderen, die Straßen und bringen die Orangenernte an den Hafen.
Merkwürdig sind die Tiere in ihrer Häßlichkeit, die etwas aristokratisches hat. Den kleinen Kopf auf ge-bogenem Hals wiegend, gehen sie einher, lassen die lange, vorgespitzte Unterlippe wie im Ekel schlaff herabhängen, blicken mit ihren schönen, dichtbewim-perten Augen hochmütig auf die Menschen rings um sich, von denen sie unterjocht sind und an denen sie sich durch eine offen zur Schau getragene, grenzenlose Verachtung zu rächen scheinen. Sie spucken auch auf alles, leicht und zielsicher, und man hält sie deshalb für boshaft, denn sie spucken meist, wenn man glauben könnte, daß sie sich ärgern. Aber sie tun es ganz verächtlich, sie spucken so erledigend, wie nur jemand, der seinen Ärger schon überwunden hat und damit fertig ist. Sie murren auch und brüllen. Be-ständig murren sie, grollen, brummen oder brüllen laut. Das habe ich vor zwanzig Jahren und jetzt wie-der in Assuan bemerkt, in Luxor, in Komombo, in Heluan, und überall, wo man auf Kamelen reitet. Sie brüllen, wenn von ihnen verlangt wird, sie sollen sich hinlegen, damit man in den Sattel steigen kann. Und sie brüllen schrecklich, wenn sie aufstehen sollen. Unterwegs murren und maulen sie beständig und das hört sich an wie eine fortwährende Drohung, wie {29} eine erregte Folge wüster Beschimpfungen. Ihr Ge-brüll aber klingt wie das Brüllen wilder Tiere, die knapp vor dem Rasendwerden sind. Man erwartet jede Sekunde irgend einen furchtbaren Ausbruch, einen tobenden Angriff, der zerstören und töten will. Aber es folgt gar nichts. Diese Tiere schleppen geduldig und brav die schwersten Lasten, tragen Menschen auf ihrem Höcker, gehen so lang man will, legen sich gehorsam nieder, stehen gehorsam auf, so oft es gefordert wird, und erfüllen das, was der Mensch ihre Pflicht nennt, viel restloser als die meisten Menschen ihre Pflichten erfüllen.
Es ist bei ihnen nur, wie bei manchen alten Dienern, die treu sind, opferwillig, unermüdlich, die es aber nicht lassen können, laut zu denken, ihren Herrn zu bekritteln und alles herauszusagen, alles vor sich hinzubrummen, was ihnen so durch den Kopf geht. Mir erschienen ihre Monologe interessant und schön. Ihre Stimme hat so viele eindringliche Modula-tionen und ihre Sprache ist so reich an Ausdruck und so beredsam, wie nur die Sprache irgendeines anderen Orientalen. Oft glaubte ich, sie zu verstehen, wenn sie ausrufen: 'Was ist nur das wieder für eine gottver-dammte Narrheit!", glaubte, es zu hören, wenn sie knurren: 'Hol's der Teufel, ich stell' mich gar nicht her, mit so einem Idioten streiten", meinte sie zu ver-stehen, wenn sie vor sich hingrollend sagen: 'Soll er schon seinen Willen haben, der Arme, der Geplagte, der Unglückliche, er ist ja doch hilflos, wenn nicht ich ihm beistehe." Und es ist mir immer ein großes {30} Vergnügen, mich in ihrer Nähe aufzuhalten, ein Stück Weges mit ihnen zu gehen, um ihnen zu lauschen.
In den Städten jedoch, oder auf Landstraßen wer-den sie, wie die Pferde, manchmal scheu, wenn sie Autos mit knatternden Motoren begegnen. Entsetzt steigen sie kurz in die Hinterbeine, spucken, knurren, brüllen und stieben mit herausquellenden Augen in ihrem schlenkernden Paßgalopp querfeldein. Ja, das eiserne Tier, das mit eiserner Stimme gleichfalls be-ständig murrt und schnaubt, flößt ihnen Grauen ein. Sie erkennen ihren Todfeind oder sie ahnen ihren Befreier.
Jetzt gehen sie ruhig ans Meer. Ich folge ihnen durch den Trubel der unteren Stadt, höre ihre Selbst-gespräche mit an, und ehe ich mich dessen versehe, bin ich am Hafen. Kann aber die Uferzeile von Jaffa wirklich ein Hafen genannt werden? Eine Landungs-stelle ist hier freilich seit tausenden von Jahren, seit die Phöniker mit ihren Schiffen von hier aus in See stachen. Ganz offen liegt die Reede von Jaffa, ganz preisgegeben dem Sturm und der Brandung. Ein Ring von Klippen und Riffen sperrt die Zufahrt, so daß die Dampfer weit draußen vor Anker gehen müssen. Ihre Fracht und ihre Passagiere werden vom Bord in kleine Boote gelassen und diese Boote rudern einen Kilo-meter, anderthalb Kilometer bis sie ans Ufer gelangen. Wenn das Meer oder der Sturm hohe Wellen wirft, ist es ganz unmöglich, an den Felsklippen vorbeizu-kommen, und es ist selbst bei bloß unruhiger See ein schweres, mitunter ein gefährliches Beginnen. Vielen {31} Leuten ist das Ausgebootetwerden vor Jaffa weit schlimmer als die lange Schiffsreise. Manche wären beinahe ertrunken, wie der Kaiser Franz Joseph, der auf seinem Weg nach Jerusalem hier landete.
Dieser ,,Hafen" ist noch genau so unangenehm, wie er zur Zeit der Kreuzzüge war und vorher, bis zurück in die graue Vorzeit. Trotzdem ist er ein belebter Platz für den Handel des Landes. Die herrliche Orange, die in Palästina wächst, die fast so groß ist, wie eine Ananas, die dicke Schalen hat, wenig oder gar keine Kerne, voll süßesten Saftes ist und zartduftenden Frucht-fleisches, und von der die englischen Ärzte heraus-bekommen haben, daß ihr Genuß der Grippe vorbeugt, heißt überall in der Welt Jaffa-Orange nach dem Hafen, von dem aus sie exportiert wird. Während ich hier bin, scheint es überhaupt nur Orangen zu geben. Jeden Tag trampeln von Früh bis Abend die langen Züge der Kamele durch die Stadt zum Hafen, beladen mit den netten, weißen Kisten, die voll Orangen sind. Sie kommen aus den Plantagen der Umgebung, kommen vom Bahnhof und schleppen abertausende solcher Kisten an den Uferkai, wo Boot nach Boot da-mit bepackt, abstößt und sacht hinausfährt zu dem großen Dampfer, der draußen liegt.
Es wimmelt und kribbelt in Jaffa von Leben, von einer kleingewerbetreibenden Geschäftigkeit. In allen Straßen und Gäßchen, in allen Basaren wühlt und wirbelt die Fülle der Gestalten stadtauf und stadtab. Einem Ameisenhaufen gleicht dieses Jaffa, das auf einem Hügel dicht am Meer erbaut ist, auf einem {32} Kogel, der vereinzelt aus der Strandebene ragt, auf einem Gupf, der über und über bekrochen ist von Hütten und Häusern, von Moscheen und Klöstern. Nichts fordert so sehr zum Müßiggang heraus, wie das fleißige Getriebe einer fremden Stadt, in der man nur ein paar Tage zubringt. Nichts reizt so sehr zum Ausruhen als das Toben einer fremden Arbeit, in deren Lärmkreis man plötzlich für kurze Zeit eintritt.
So sitze ich denn behaglich auf der Terrasse eines kleinen arabischen Kaffeehauses, dicht am Ufer. Man kann nichts von all den Dingen, die dem Gast hier ge-boten werden, genießen. Kaum den Mokka, der nicht eben nach Mokka duftet. Denn es ist eine Schenke für Hafenarbeiter und Ruderknechte. Aber weil es eine Schenke für Moslims ist, wo es keinen Schnaps und sonstigen Alkohol gibt, geht es auch ohne jede Be-soffenheit zu, ganz still, sehr anständig und überaus manierlich. Es ist prächtig, hier zu sitzen, Zigaretten zu rauchen und in die Sonne zu schauen. Diese Terrasse bildet den Rest einer alten Festungszinne. Ir-gend ein Vorwerk, ganz am Strand errichtet, hatte die niedrige, dicke Mauer hier, die einen Wehrgang trug. Jetzt trägt sie die Tischchen und die Stühle eines Kaffeesieders. Von der Seeseite lecken die Wellen an den alten, weißgrauen Quadern, und vom Land her spült das Wogen des arbeitsamen Alltagsleben mancherlei Hausierer, Bettler und andere seltsame Ge-stalten hier herauf.
Ich blicke behaglich rund umher, schaue auch mal zu Boden vor mich hin und plötzlich fällt es mir ein, {33} wie viel Blut diese Steine da unter mir schon getrunken haben mögen. Gegen diese Mauer da stürmten die Kreuzfahrer in ihrer großen, aber wenig geistvollen Begeisterung, hier stürmten, viele Jahrhunderte später, die Soldaten Napoleons, in einem Enthusias-mus, der nicht viel klüger war. Immerfort ist im Lauf der Zeiten um Jaffa gestritten worden. Die Phöniker besaßen die Stadt, die Ägypter sind da Herren ge-wesen, Jonathan eroberte sie den Juden, denen sie erst Pompejus entriß und denen sie Julius Cäsar wieder zurückgab. Vespasianus hat die Stadt zerstört. Sie er-hob sich wieder. Dann hat Beibars, der in Ägypten Sultan war, Jaffa dem Erdboden gleichgemacht und wiederum entstand es langsam. Bis in dunkle Urzeit reicht die Erinnerung an Kampf und Krieg zurück.
Hier kämpften Tiere im Namen Gottes gegen Men-schen, wie der große Walfisch, der den Propheten Jonas da draußen auf dem Meere verschlang, und hier kämpften Menschen unter dem Beistand der Götter gegen Ungeheuer, wie Perseus, der ein Sohn des Zeus und der geldliebenden Danae gewesen ist. Er tötete hier den Drachen und befreite die schöne Andromeda, die da draußen an einen der Klippenfelsen gebunden war.
{34}
IV
Viele Straßen durchlaufen das Land über Berg und Tal, schlüpfen tief durch Schluchten und Hohlgänge, steigen hoch, zu Gipfeln empor. Straßen gibt es, die breit sind, ausgezeichnet zu befahren, gepflegt, mit festem Unterbau, glatt gewalzt, und noch mehr ge-glättet von den Pneumatiks der vielen Automobile, die drüber hinsausen. Straßen, die sich wie weiße oder gelbe Bänder durch das Grün der Hügel hinziehen, die, von ferne schon, wie feine Adern den Leib dieser Erde mit verästelten Linien durchschimmern. Straßen, die sich gleich Schlangen um die vorgewölbte Brust eines Berges ringeln. Dann sind verlassene, alte Straßen da, grasbewachsen, schwer zu finden und schwerer noch zu benützen, verkrustet und über-wuchert vom Bodenwuchs wie verjährte Narben im Fell eines alten, vielgejagten Tieres. Alle diese Straßen, die jetzt noch vortrefflichen und die verschwindenden, haben Juden und Römer gebaut, Syrer, Araber, Kreuz-fahrer, Türken und andere, viele andere.
Fast alle Völker der alten Welt sind hier im Land gewesen, um es zu erobern, um es zu besitzen, um es aufzurichten und um es zu zerstören. Im Namen ihres Glaubens, im Zeichen ihres Gottes, auf Betreiben ihrer Priester, {35} ihrer Könige, gespornt von ihrem Ehrgeiz, von ihrem Fanatismus, gepeitscht von unbelehrbarer Dummheit oder von erbarmungsloser Gier nach Reichtümern ge-hetzt. Fast alle Völker haben sich in das offene Buch dieses Landes eingezeichnet. Man liest die Geschichte ihres Charakters von den Befestigungen, die sie hinter-ließen, von den Ruinen ihrer Burgen und aus den Zeilen der Straßen, die sie bauten. Immer noch kann man auf diesen Straßen des Nachts, auch am hellichten Tag überfallen oder von einer Kugel aus dem Hinter-halt ausgelöscht werden, wenn man allein im Auto fährt, weshalb denn auch die Chauffeure hier nur un-gern mit einem Einzelpassagier losziehen oder gar ihre Rückfahrten ohne Passagier machen. Sehr oft sind es ganz gewöhnliche Räuber, die solch einen Überfall vollführen, manchmal sind es Politiker. Aber es gibt Fälle genug; in denen der Räuber mit dem Politiker identisch ist, Fälle wieder, in denen man schwer entscheiden könnte, wo der Politiker aufhört und der Räuber anfängt. Das ist übrigens nicht bloß in den arabisch-levantinischen Ländern so!
Die Berge von Judäa sind hoch. Bis zu tausend Metern und darüber. Ineinander getürmt liegen sie ge-waltig da, bilden tiefe Talrinnen und grüne Wiesen-betten zwischen ihren Erhebungen, tragen die Häupter stolz in den blauen Himmel gehoben, steinerne, kahle Köpfe oder Hochplateaus mit zerklüfteten Abhängen. Fast ganz verkarstet, geben sie den Eindruck ma-jestätischer öde. Sie sehen aus wie einsame Vulkane, denen die herabgeronnene Lava den ganzen Leib {36} verbrüht hat. Nur spärlich deckt da und dort ein dünner Graswuchs das Gestein, wie Schorf die wunde Haut eines Menschen überzieht.
Ja, dieses Land, einst das gelobte, dieses Land der Verheißung, darin Milch und Honig floß, es ist nun lange schon öde, verkarstet und wund. Das Gebirge von Judäa ist nicht vulkanisch; es hat einst, vor vielen Jahrhunderten, herrliche, dichte Wälder auf seinem breiten Rücken getragen, darinnen viel Wild lebte, Ga-zellen, Bären und der edle Hirsch. Üppige Matten breiteten sich talwärts in sanften Lehnen und auf ihnen weideten die Rinder, Schafe und Ziegen, furchte der Pflug den fetten Boden.
Ein Volk, das unruhig, streitbar und stolz war in seinem Geist, lebte hier glücklich, auf eigener Scholle. Unausdenkbar, wenn dieses Volk niemals vertrieben, niemals hingestreut worden wäre über die ganze Erde, wenn es hätte weiterleben dürfen in seiner Heimat. Unübersehbare Perspektiven ins Banale, in eine Reihe von Jahr-tausenden, die nur Ereignisse, aber kein Schicksal ent-halten hätten. Doch dieses Volk gab der Welt einen Gott, gab ihr den göttlichen Gedanken einer unsicht-baren Allmacht und gab ihr etwas von der eigenen Un-ruhe. Dies Land hier ist, auf dieser Hemisphäre, das vulkanische Gebiet der Menschheit gewesen. Die Feuerströme, die sich über die Erde ergossen, sind hier hervorgebrochen, aus den Herzen derjenigen, die in Judäa und Galiläa geboren waren. Und wenn heute der Boden hier von den Gipfeln bis zu den Tälern verbrannt ist, rührt das nicht von der glühenden Lava {37} her, die aus dem Innern der Erde aufsprang, sondern von den Seelengluten der Menschen, die den Erdkreis entzündet und erleuchtet und darüber ihr eigenes, kleines Land verloren haben.
Dieses Land, seit sein eingeborenes Volk aus den Wurzeln gerafft und verschleudert wurde, ist immer-fort nur Beute gewesen; Beute, die man errungen hat, oder Beute, die man erjagen will. Und man hat es so wenig geschont, so wenig gepflegt, wie man eben eine Beute, von der man nicht weiß, wie lange man sie behalten wird, schont oder gar pflegt. Gleich einem Stück Knochenfleisch, um das sich wütende Hunde raufen; ist dieses Land zerzaust, zerbissen, zerrissen und zerfetzt worden.
Mehr als tausend Jahre lang hat hier niemand einen Baum gepflanzt. Nur gefällt hat man Bäume, ganze Wälder hat man niedergeschlagen. Berg um Berg wurde des dichten, kostbaren grünen Mantels beraubt, der die Erde schützte. Man hat das Dickicht der hohen, alten Stämme vernichtet und das Dickicht von Busch und Strauch zerstört. Langsam wurde der Reichtum dieser weithin gedehnten Wälder zu einer kahlen, öden Armut gewandelt; es wich der kühle Schalten herrlicher Bäume, darin Menschen und Tiere sich ergingen, und immer mehr breitete sich die Wehrlosigkeit entblöster Hänge, die der glühenden Sonnen-schein verbrannte, die der Sturm mit ungehemmter Kraft durchwühlte und auf die der wütende Regen niederpeitschte.
Dieses arme, von habsüchtigen Händen bis zur {38} Nacktheit ausgezogene Land konnte nicht widerstehen. Der Regen wusch in Jahrhunderten den fetten Humus von den Lenden, Schultern und Rücken der Berge so gründlich, bis das Urgestein zum Vorschein kam. Wer Griechenland gesehen hat, die kahlen Heiden um Kon-stantinopel, Kleinasien und Palästina, der versteht den Ausdruck 'türkische Wirtschaft", der jetzt hoffentlich für alle einst von den Türken beherrschten Gebiete wie für die Türken selbst der Geschichte angehört.
Nichts mehr ist dieses Land, als der leergeräumte Boden für eine Aufgabe. Nichts anderes ist es, wie die Stätte für einen Anfang. Nur die Aufforderung, die Gelegenheit; der Mahnruf, der Notschrei, der Alarm zur Arbeit.
Die Jugend Israels arbeitet hier. Sie arbeitet so hart wie einst unter der Herrenfaust des Pharao. Vielleicht härter noch und schwerer. Aber diese jungen Men-schen arbeiten freudig, aus freiem Entschluß, mit dem Feuerfunken der Hoffnung im Herzen. Sie klopfen Steine und bauen Straßen. Sie stehen bis an die Knie im Schlick und ziehen Gräben, um Sümpfe zu trocknen. Und sie tragen, in Handkörben, den Humus wieder die Berg hinauf, bedecken die wunde, unfruchtbare Nacktheil der steinigen Wände wieder mit guter Scholle. Sie pflanzen wieder Bäume, überall. Sie pflanzen den Eukalyptus in den Niederungen, weil er das Grundwasser wegtrinkt und weil er schnell wächst. Sie setzen Ölbäume und Maulbeer- und Obstbäume und Palmen an die Berglehnen, damit von ihren Wur-zeln das Erdreich gehalten und vom Regen nicht mehr {39} niedergeschwemmt werde. Ach, es ist noch wenig zu sehen, obwohl sehr viele Bäume gesetzt wurden. Aber alles, was bis zum Jahre 1914 schon seine Wipfel hob, hat dann der Krieg unerbittlich niedergehauen. Auch seit dem Krieg ist viel gepflanzt worden und vieles wieder zur stattlichen Höhe gewachsen. Doch in diesem baumlosen Land, in diesem verkarsteten Gebirge sieht das nach gar nichts aus, kaum wie der An-fang eines Anfanges, und die Kahlheit ringsumher tritt nur noch erschreckender, nur verzweifelter noch hervor.
Steht irgendwo, am Bergesabhang, ein Grüppchen Bäume, dann zeigt Chaim Mandelbaum, der Chauffeur, stolz darauf hin und sagt schon: 'Ein Wald!" Er kennt jedes Baum im ganzen Palästina und liebt ihn. Er weiß, wie er gedeiht, und beobachtet sein Wachstum. Er hat alle die Bäume gekannt, die lebendig waren, als der Krieg ausbrach und die dann gefällt wurden. Er zeigt die Plätze, an denen sie standen, und er trauert um sie, wie man um Kriegsgefallene trauert. Chaim Mandelbaum ist nicht der einzige. Alle jüdischen Menschen hier kennen jeden Baum im Lande und sprechen davon wie von Angehörigen, die man liebt, wie von Kindern, die man pflegt und hütet.
Nun beginne ich, den Sinn zu begreifen, den ein-zigen Sinn, den die Verwüstung Palästinas haben kann, und ich bin nicht mehr so entsetzt, bin gar nicht mehr so verzweifelt über den trübseligen Zustand des Bodens, wie in den ersten Tagen. Dieses Land ist niedergetreten, ausgeplündert, mißhandelt worden und es ist verschmachtet, als es sein Volk verloren {40} hatte. Aber auch das Volk hat man niedergetreten, ge-plündert und mißhandelt, seit es von seiner gottgegebenen Scholle verjagt wurde und es ist ver-schmachtet seither. Wohin sollte dieses verfolgte, dieses verstoßene Volk sich wenden, was für ein Ziel könnte es in dieser Welt noch haben, was für einen Halt und was für einen Daseinswillen, wenn dieses Land nicht daliegen und warten würde? Nichts bliebe dem Judenvolk übrig, als die vollkommene Auf-lösung, als das Untergehen im Meer aller anderen Völker. Längst wäre der Untergang schon hereinge-brochen, längst die restlose Auflösung schon vor sich gegangen, und Israel wäre spurlos verschwunden im Orkan von neunzehn Jahrhunderten, in diesen Stür-men, von denen es umhergeschleudert wurde, ein Wrack, ohne Segel und Steuer.
Aber das Land lag da und wartete. Das Land hatte sich niemals wieder erholt, seit ihm die eingeborenen Kinder weggerissen wurden, entwurzelt, wie ihm nach-her der Wald mit allen Bäumen von der Brust der Gebirge gerissen worden ist. Das Land lag da, es litt und wartete. Es tat genau dasselbe wie die Juden: Leiden und Warten, neunzehn Jahrhunderte lang. Aber neuzehnhundert Jahre sind keine zu lange Zeit für dieses Land! Und es zeigt sich, daß neunzehn-hundert Jahre auch für das Volk nicht zu lange sind.
Dieses Volk ist in der Verbannung städtisch ge-worden und ... Einen Augenblick! Die Verbannung umnebelt uns mit so vielen Lügen, daß man sie bei-nahe nachspricht wie ewige Wahrheiten.
{41} Die Juden sind also städtisch geworden; sie sind dem Handel ergeben und jedem Schacher, der Geld bringt, denn sie lieben das Geld über alles? Nun ja, man hat sie in Städte eingepfercht, hat ihnen in den Städten besondere Quartiere anbefohlen und sie im Ghetto gehalten. Man hat ihnen den Besitz von Boden untersagt und ihnen das freie Wohnen auf freier Scholle verboten. So sind sie städtisch geworden! Ihnen war der Zugang in die arbeitenden Berufe, in die Zünfte des Handwerks gesperrt und so mußten sie sich dem Handel ergeben. Aber da war einmal in Kastilien irgendein König, Alfonso oder so ähnlich, der emanzipierte die Juden eines Tages und sofort hingen, siebzig von hundert, die Männer ihren Handel an den Nagel, um die Universitäten des Landes zu beziehen, darunter Fünfzigjährige. So leidenschaftlich sind die Juden dem Handel ergeben! Es war ein Ausbruch, eine Explosion der vulkanischen Volksseele und der Lügen-nebel des Ghettos wurde davon entzweigerissen. Aber vor vielen Jahrhunderten, und nur für einen Moment.
Dieses Volk liebt das Gold? Doch wohl nicht viel stärker als alle anderen Völker am Golde hängen, nach Golde drängen. Unter der Bauernschaft, den Grund-besitzern und Reichen der ganzen Welt ist es eine ganz besondere, eine ganz vereinzelte, eine ganz seltsame Ausnahme, wenn einer je die ideale Gelehrsamkeit, die Künste, die Wissenschaft, die Weisheit höher achtet, als den eigenen Reichtum, wenn er sie so sehr verehrt, daß er sein Geld und sein Tagewerk diesen idealen Gütern dienstbar macht.
Doch bei den Juden, {42} soweit sie von der Angleichung ihren Traditionen noch nicht entfremdet, in ihrer Wesensart noch nicht ent-färbt sind, gilt Wissen und Weisheit mehr als Besitz. Geld ist gut, denn Geld kauft ein Stückchen Daseins-recht, kauft Licht und Luft, besonders in den Ländern, bei deren Beamtenschaft solche Dinge bis vor kurzem käuflich waren und morgen vielleicht wieder zu kaufen sein werden. Die anderen freilich haben dieses Daseinsrecht, haben das bißchen Sicherheit selbstver-ständlich umsonst. Doch der Jude muß alles bezahlen, was er haben, was er bewahren, was er erhalten will. Er muß ja auch in den sogenannten freien Ländern den Umgang mit Vornehmen, die gesellschaftliche Stellung bezahlen. Oh, wie lache ich in den Fluren Palästinas über die gesellschaftliche Stellung so vieler arrivierter Juden, über den Ehrgeiz dieser sonst so be-gabten Männer, über den Snobbismus ihrer Frauen. Ich rechne mir aus, wieviel Bäume hier im Lande ge-pflanzt werden könnten um all das Geld, das diese Leute opfern, damit ein paar Aristokraten zu ihnen ins Haus kommen oder damit sie in den nobeln Klubs geduldet, damit sie zu den großen Soireen geladen werden. Ich denke mir aus, wieviel Bäume... und schon bedecken sich alle diese verarmten Berge hier mit rauschenden Wäldern. Ich stelle mir vor, wieviel Geld täglich von diesen Verblendeten hingeschüttet wird, nur aus heißer Sehnsucht, ihr Judentum ver-gessen zu machen oder wenigstens Vergebung zu er-langen für das jüdische Blut, das einem doch keiner je vergißt oder vergibt; ich überlege, wieviel Dunam {43} Ackerboden man dafür kaufen, wieviel Arbeiter man ansiedeln könnte für dieses sinnlos verschwendete Geld, und schon sehe ich im Geiste das ganze Land vor mir, emsig bewirtschaftet, aufblühen in segens-reicher Fruchtbarkeit. Da vergeht mir das Lachen.
Diese Juden, die auf allen ihren Wegen Flüchtlinge des eigenen Blutes sind, wissen nichts mehr vom Judentum. Und die Christen wissen erst recht nichts davon. Sie wissen nicht, daß ein jüdischer Vater sich's zur höchsten Ehre, seiner Tochter zum höchsten Glück anrechnet, ihr einen Gelehrten zum Manne zu geben. Er plagt sich gerne, dieser Vater, den Schwiegersohn die Tochter und die Enkelkinder zu ernähren, denn er hält sein Haus nun für geadelt weil er das Heim ist für selbstloses Denken, für For-schen, Erkennen und Weisheit.
Viele Ehen werden im Volk, das diesen Namen noch verdient, derart ge-schlossen, daß der Reiche den armen Philosophen als Tochtermann ins Haus nimmt. Auch in der Demo-kratie, die dem jüdischen Volke eigen ist, die ihm von altersher in den Instinkten sitzt, verschafft weder Be-sitz noch Macht den Adel, sondern es ist einzig der Geist, der adelig sein läßt. Aber was weiß man in ge-wissen großstädtischen Salons davon?
In ihrem Ghetto sind die Juden Handwerker und Arbeiter, sie sind Lastträger und Schmiede, Schlosser und Tischler, wie sie Uhrmacher und Juweliere sind. Wo sie mit dem Boden je zusammenkommen durften in der Verbannung, sind sie tüchtige Landwirte, Vieh-züchter und Weinbauern. Die Güter, die in Ungarn {44} von Juden verwaltet wurden oder gepachtet oder als Eigentum betrieben, beweisen es. Und ein Fürst Urussow, der in den Achtzigerjahren Gouverneur der Ukraine war, in einem Gebiet, in dem die Juden Land besitzen durften, wundert sich in seinen Memoiren maßlos über den Ackerbau wie über den Weinbau der Juden, der nach seinen eigenen Worten dem Weinbau am Rhein in nichts nachsteht. Er ist als Russe der herrschenden Klasse kein Judenfreund ge-wesen, dieser Fürst und Gouverneur, dennoch meint er, es wäre vielleicht vorteilhaft, den Juden die Er-laubnis zu geben, sich auch in anderen Gegenden des großen Rußland anzusiedeln, damit die Trägheit der russischen Bauern durch ihr Beispiel befeuert werde. Und er sagt das alles mit einem Erstaunen, das ganz ohne Wohlwollen ist.
Kein Mensch wundert sich, wenn von den Juden das Schlechteste behauptet wird; aber jeder gerät in sprachloses oder stotterndes Staunen, wenn er ein Gutes an ihnen bemerkt. Die Juden wissen von ihrem eigenen Volk nur sehr, sehr wenig; die anderen aber ahnen nichts vom jüdischen Wesen und so ist es ge-kommen, daß die Juden unter allen Völkern fast gar nicht gekannt und am meisten gehaßt werden. Rich-tiger: sie werden am meisten gehaßt, weil sie gar nicht gekannt werden.
Jetzt ist Palästina die große Gelegenheit für die Juden, ihre wahren Kräfte zu zeigen. Ihr Rhodus ist es; hier müssen sie beweisen, wie sie tanzen können, müssen es für sich beweisen und für die ganze Welt.
{45} In diesem Land, das so lange gelitten und gewartet hat, wird niemand gebraucht, der sich nur auf die Listen und Kniffe des Ghetto, auf die Schliche der Diaspora versteht, niemand, der nur den Kuhhandel der Angleichung kennt. Aber jeder ist nötig, der die Bereitschaft hat, mit seiner Hände Arbeit zu helfen, daß der Boden hier wieder fruchtbar werde, jeder, der den Opfermut mitbringt, sein Leben hinzugeben dafür, daß diese Äcker wieder Ernten tragen und auf den Berghängen wieder Wälder rauschen. In dieser übermenschlich mühevollen Arbeit wird dem Volk wieder diejenige Schichte erzogen, die ihm so lange gefehlt hat: die im Erdreich Wurzelnden, die mit ihrem Körper und mit ihren Muskeln Schaffenden, die Einfachen, die Unhysterischen, die Beständigen.
Niemand sonst vermag es, dieses Land zu retten. Die Araber besitzen unermeßlich weite Gebiete, und der Entwicklungsweg, den sie zurücklegen müssen, ehe sie zur Höhe intensiver Wirtschaft gelangen, ist noch sehr, sehr lang, obwohl sie intelligent und fleißig sind. Aber sie gebieten über riesengroße Länderstriche, sie haben Zugänge zum Mittelmeer, die bessere Hafen-plätze bieten als die an Buchten arme und an Klippen reiche Küste von Palästina. Sie können überdies noch an das Rote Meer und an den Indischen Ozean. Das kleine Palästina ist ihnen keine Lebensnotwendigkeit. Und wenn sie nicht verhetzt sind, sehen sie Palästina auch gar nicht als Lebensnotwendigkeit an.
Die Christenheit der ganzen Welt wäre nicht im-stande, das Heilige Land wieder in ein Land zu wandeln, {46} das dem Gelöbnis Gottes keine Schande machen würde. Denn um diese Wandlung zu vollziehen, braucht es Dezennien, braucht es vielleicht ein Jahr-hundert angespanntester Arbeit, und zur Anspannung wie zur Stetigkeit solchen Wirkens gehört ein großer, einheitlicher Wille, aus der Seele eines einzigen, ein-heitlichen Volkes.
Aber die Christenheit zerfällt in viele Nationen, die einander, manchmal blutig, bekriegen und die auch in Friedenszeiten leider nicht davon lassen, mit-einander zu rivalisieren. Außerdem ist die Christenheit durch viele Bekenntnisarten getrennt, die sich gegen-seitig immerfort bekämpfen. Es gibt zwischen römischen Katholiken und orthodox Rechtgläubigen, wie sich die russisch-griechischen Konfessionen nennen, zwischen Katholiken und Protestanten wohl keinen offenen Krieg, aber auch niemals einen Frieden. Und gerade auf dem Boden von Palästina gerät dieser Gegensatz jedesmal in Brand, ist gerade hier eigentlich beständig im Glimmen. Die Flammen des Zankes jedoch haben noch immer jedes Haus, das feindliche Parteien miteinander bauen wollten, in Asche gelegt, ehe es vollendet war.
Die Juden dagegen sind von Urzeiten her mit Pa-lästina verknüpft und verbunden. Es ist ihr Land, ihre Wurzelerde und da zwei Jahrtausende die Fäden nicht zerreißen konnten, mit denen Volk und Land zu-sammenhängen, wird Palästina immer das Land und die Wurzelerde der Juden bleiben, in Ewigkeit. Amen.
Alle Nationen der Erde haben in einem offiziellen {47} Akt diesen Zusammenhang anerkannt. Der große Wille zum Wiederaufbau lebt glühend in dem Volk, das über die ganze Welt zerstreut ist. Aus allen Himmels-richtungen zieht die Sehnsucht dieses Volk hieher, eilen die Arbeitsfreudigen, die Opferwilligen herbei. Palästina vereinig! Wille, Sehnsucht. Denken, Hoffen und Schaffensdrang der Juden, wie das Brennglas die Strahlen der Sonne.
Den Arabern, die im Lande und rings um das Land in großen Gebieten wohnen, sind die Juden stamm-verwandt; und wenn sie nicht politisch verhetzt sind, werden die Araber erkennen, wie viel Antrieb und An-kurbelung ihren eigenen motorischen Kräften durch die Arbeit der Juden zuteil wird, welch ein Auf-schwung ihren eigenen Ländern durch die geordnete Arbeit der Juden in Palästina bevorsteht. Von euro-päischen Einflüssen, auf die Dauer nicht zu stören noch zu hindern, wird sich die Verbrüderung mit den Arabern vollziehen, wird sich vollziehen müssen als die einzige, wirklich feste Grundlage für das Bestehen Palästinas wie für das Bestehen eines freien Arabien.
Dieses winzige kleine Fleckchen Boden wird man den Juden, die hierher kommen, um es mit ihren Händen zu bebauen, mit ihrem Schweiß zu tränken und mit den Leibern ihrer Toten zu düngen, wohl gönnen müssen, da man ihnen doch sonst jede andere Scholle auf der großen weiten Erde als Heimat ver-weigert. Auch die Heiligtümer wird man in ihre Ob-hut geben müssen, da man sie doch so lange in der Obhut der Türken lassen mußte! Man darf gewiß sein, {48} sie werden ebenso viel Pietät zeigen wie die Türken und sie werden die Priester nicht stören. Daß für die christlichen Stätten Schließung zu besorgen wäre, wenn die Juden einmal zu reden haben, ist törichte Verleumdung.
Sie sind ja aus ihnen, aus den jüdischen Heilig-tümern entstanden, diese geweihten Stätten des Christentums, sie sind aufgebaut auf den Trümmern jüdischer Heiligtümer und sie sind gar nicht zu den-ken, wenn diese nicht vorher gewesen wären. Niemand vermag das Land zu retten als die Juden, und durch nichts in der Welt kann das Judentum gerettet werden als durch dieses Land.
Nun bin ich auf der Straße gefahren, die aus dem Gebirge sacht hügelabwärts niederleitet zur Ebene. Bei Amwas, dem Dorf, kam ich vorbei, das vor Zeiten Emmaus geheißen hat, und wo Juda Makkabäus siegreich kämpfte. Mein Auto saust durch die Ebene Schephela, vor mir glänzen wie goldene Seide die fernen Dünen, blitzt in Sonnenfunken das Meer auf, um mich her grünen die Felder, weit hinter mir blauen die Berge von Judäa.
Mir zittert das Herz, so stark fühle ich hier den ungeheuer andauernden Zusammenhang, der in zwei Jahrtausenden nicht zerreißen konnte. Es ist das Land der Verheißung, immer noch!
Es ist das Land, das verdorrte, weil es wartend lag; das wieder aufblühen will. Laßt es nicht warten!
Rechts und links der Straße sehe ich die grünen Matten und gelben Äcker gesprenkelt mit weißen, {49} beweglichen Tupfen; das sind die Männer der ersten Hilfe, das sind die Jünglinge, die den wunden Boden hier heilen und in ihrer Seele gesund werden an dem Heilungswerk, das sie vollbringen. Das sind die jungen Brüder, die ihr Leben einsetzen und die verloren sind, wenn nicht wir alle zu ihnen halten, wenn nicht wir alle wenigstens halbwegs unsere Pflicht tun, da sie doch mehr, weit mehr tun als bloß ihre Pflicht.
Mit einemmal denk ich des reichen Mannes in Kairo wieder, der mir gesagt hat: 'Es ist nichts los in Pa-lästina ..."
Und ich lächle.
{50}
V
Unter den hohen Eukalyptusbäumen gehen wir spazieren. Mein Begleiter ist ein junger Mensch, fast noch ein Knabe, sehr zart, sehr zierlich und ganz hell-blond. Sein Teint hat ein so absolutes Weiß, daß er unter der Sonne hier nicht braun wird, sondern rot brennt. Rot flammen ihm die schmalen Wangen und rot ist seine Brust, wo das offene Hemd sie freiläßt. Er führt mich in der ganzen Farm umher. Die Ent-stehungsgeschichte dieser großen landwirtschaftlichen Schule interessiert ihn nicht besonders, vielleicht weiß er auch nur wenig davon. Aber die Arbeit, die heute in Mikwe-Israel verrichtet wird, die Arbeit, die gestern geleistet wurde und morgen getan sein muß, hat sein ganzes Interesse gefangengenommen, ihr hat er sein ganzes Wesen mit aller Leidenschaft ohne jeden Vor-behalt hingegeben.
Er freut sich, daß er Mikwe-Israel zeigen darf, daß er alles erklären, alles schildern und besprechen soll. Seine Freude ist ruhig und vollständig im Sachlichen haftend; man merkt sie ihm nur an den Augen an, in denen Bereitwilligkeit strahlt, nur an dem hübschen Gesicht, davon jeder Zug aufrichtig, einfach und jungenhaft herzlich ist.
{51} Mikwe-Israel gleicht einem mittleren Gutsbesitz und die Zöglinge bebauen den Boden unter den Anleitungen der Lehrer. Diese Arbeiten bilden das Praktikum ihrer Lehrzeit; Schulunterricht in den landwirtschaftlichen Fächern erhalten die jungen Leute, wenn kein Feld be-stellt, kein Orangengarten gepflegt werden muß. Das ist ja überall in den Farmschulen der Fall. Sie wohnen in einem großen Hause mit den Lehrern beisammen; auch andere Wohnhäuser für Lehrer und Gärtner sind da, ebenso eine kleine Synagoge. Sie steht mit Scheunen, Ställen, Schmiede und Werkstätten am Ein-gang der Farm. Wenn man, von der großen Straße, die Jaffa mit Jerusalem verbindet, abbiegt, die Allee herauffährt, und das hohe Gittertor passiert, ist man gleich auf dem 'Hof", der weiträumig hügelan sich dehnt. Schon kommt man, zwischen dichtem Grün, zu den Wohnhäusern. Und dann ist man, hier umher-gehend, in einer kleinen, eigenen Welt, die ganz für sich abgeschlossen lebt und offenbar zufrieden damit, so ganz für sich zu sein.
Vor bald sechzig Jahren hat ein Mann, der Charles Netter hieß, diese Schulfarm gegründet. Das war die Epoche, die fast überall in Europa den Liberalismus zur Herrschaft schreiten sah. Die Jünglinge, die anno 1848 Revolution gemacht hatten, waren Männer ge-worden und schickten sich an, nun der Absolutismus auf den Schlachtfeldern zusammengebrochen, keinen erheblichen Widerstand mehr leisten konnte, ihre Ideen zu verwirklichen. Das war die Zeit, in der die Juden überall den Traum einer Versöhnung, einer {52} wirklichen Gleichberechtigung träumten und sich ein-bildeten, nun, da die Gegensätze der Konfessionen durch das glorreiche Werk der Aufklärung über-wunden seien, werde es, könne es nichts mehr geben, das ihr sehnsüchtiges Herz vom Herzen aller anderen trennte.
Was würden sie sagen, was empfinden, diese Männer, die alles aufs beste bestellt glaubten, als sie schlafen gingen, wenn sie heute aufwachten, und die gehässige Zerrissenheit sehen würden, die ärger ver-giftet ist denn je? Was würden die jüdischen Studenten sagen, die auf dem Pflaster von Wien und Berlin ihr Blut verspritzt haben für die Sache der Freiheit, wenn sie heute an den Universitäten in Deutschland und Öster-reich statt jener Menschlichkeit von achtundvierzig, die engstirnige Brutalität der deutsch national aggressiven Gesinnung fänden?
Der treffliche Charles Netter ließ es sich wohl kaum einfallen, daß er einer der ersten Schrittmacher für den Aufbau des jüdischen Palästinas sei, als er vor nun fast sechzig Jahren hierherkam und Mikwe-Israel gründete. Er wollte damals die Jugend im Lande, in Syrien und Kleinasien, die jüdische Jugend des Orients auf dem historischen Boden von Palästina zu Ackerbauern erziehen. Ich denke mir, er hat sich vor-gestellt, die Judenschaft, die hier die Scholle bearbeitet, werde dereinst, etwa um 1924, der befreiten, gleichberechtigten Judenschaft Europas würdig sein. Er war voll Enthusiasmus für seine schöne Idee; er drang durch, gründete mit Hilfe und im Auftrag der Alliance Israelite Mikwe-Israel, er war voll Hingabe an sein {53} Werk, das er eingerichtet, in Gang gesetzt und geleitet hat. Aber er starb schon nach wenigen Jahren, ehe noch die ersten Enttäuschungen sich einstellten. Jetzt liegt er hier begraben, auf der höchsten Höhe der breiten Bodenwelle, die Mikwe-Israel einzäumt, nahe der Stelle, wo der Baumgarten, das Buschwerk der Farm sich öffnet zu den Äckern und zum freien Land. Sein Name, der den einfachen Grabstein ziert, sein Leib, der hier in der Scholle modert, ist von einer kleinen Unsterblichkeit umgeben, die, ganz an die Scholle gebunden, mit der Erde ringsumher weiter-lebt.
Noch war die Zeit nicht erfüllt, als diese Farm hier entstand. Noch war den jungen Menschen, die hierher-kamen, um zu lernen, kein gemeinsames Ziel vor die Seele gerückt. Sie fanden sich aus zufälligen Einzel-wünschen hier zusammen, nicht gesendet, getrieben, geschleudert vom Pulsschlag einer großen Volksbe-wegung. Immer hatte Mikwe-Israel Schüler, die Land-wirte werden wollten, aber nur wenige von ihnen wurden wirklich Bauern, die meisten verstreuten sich in viele andere Berufe. Nun aber ist seit dem Kriegs-ende ein einheitlicher Entschluß und Schritt, wie über-all in der Bodenarbeit des Landes, also auch hier. Sie lernen in Mikwe-Israel das Feld bestellen, sie ziehen den Pflug durch die Ackererde und säen Weizen. Sie pflanzen Wein, Orangen und Ölbäume, sie pflegen Blumen und Zierpflanzen, die im nahen Jaffa nach allen möglichen Teilen des Landes wie der Nachbar-länder verkauft werden; sie halten viele Bienenstöcke {54} und gewinnen Orangenhonig, und sie beginnen jetzt auch Tabak zu bauen.
Es sind heute auch nicht mehr die Juden des Orients allein, für deren Jugend diese Farm wirkt. Sie kommen nun von überall hierher, die jungen Männer, und der Jüngling, der mich führt, ist aus Ber-lin. Ich habe ihn liebgewonnen, diesen braven, tüch-tigen Burschen, der achtzehnjährig fort ist aus dem Vaterhaus, weg von den Annehmlichkeiten der Groß-stadt, weg von blödsinnigen Beschimpfungen, in denen deutsche Studenten ihren nationalen Geist austoben. Er ist erfrischend, dieser sanfte junge Mensch, der nun hier lebt, in der Zwilchhose und im Hemd des Ar-beiters, hier unter dem blauen Himmel Palästinas, im Duft der Orangenblüten, im Salzwind des nahen Meeres. Er hat seine Bildung, dieser Junge, denn er hat seine Matura gemacht, ehe er abfuhr von Berlin, er hat seine, geistigen Interessen und er hat hier seine schwere körperliche Arbeit. Kerngesund ist er, heiteren Gemüts und seine Klugheit ist beschwichtigt durch die heilsame Berührung mit dem Boden; diese helle Klugheit hat keine Schärfen, wie sie der jüdische Ver-stand so oft aufweist. Die ätzende Schärfe kommt frei-lich aus den Wunden, aus den vielen, vielen alten und neuen Wunden, die dem jüdischen Gemüt und dem jüdischen Verstand so tausendfach geschlagen werden.
Bei dem Jungen da sind alle Wunden spurlos ver-narbt, er hat vergessen, er hat verziehen, ja er ver-steht kaum noch etwas von dem Haß und Hader, der Deutschland zerfrißt. Unbefangen steht er neben mir {55} auf der Anhöhe von Mikwe-Israel, kennt nur noch das Land, das Heute und Morgen seiner Arbeit, die dem Lande gilt. Er ist das Kind einer neuen Zeit, die eben erst anbricht und er hat die zarte Frische ihrer ersten Morgenstunde.
Der alte Charles Netter, der da vor unseren Füßen in seinem Grabe liegt, würde sich freuen mit dem Jun-gen, und ihn sicherlich lieben. Denn der Junge ver-körpert ein Ergebnis, das alle Hoffnungen, die Charles Netter einst gehegt hat, auch die kühnsten, weit über-trifft.
{56}
VI
Man sagt Kolonie, wenn man von Rischon le Zion spricht, weil man alles, was in eine fremde Be-völkerung eingepfropft ist, alles, was in dieser Art als Experiment angefangen hat, Kolonie nennt. Aber Ri-schon le Zion ist ein jüdisches Bauerndorf, mit seinen fünfzehnhundert Einwohnern und mit seinem Grund-besitz von etwa fünfzehntausend Dunam schon ein stattliches Bauerndorf. Es hat eine Klinik und eine Apotheke, ein Volkshaus, eine Schule, einen Kinder-garten, eine Talmud-Thora-Schule und ein öffent-liches Bad. Dieses merkwürdige Dorf hat auch ein Eukalyptuswäldchen und einen Park, um darin zu lustwandeln, mit herrlichen Palmenalleen, und es gibt sogar 'Hotels" da. Auf dem höchsten Platz von Rischon le Zion steht weithin sichtbar, der Tempel, und das hat dieses Dorf jüdischer Bauern mit fast allen Dörfern christlicher Bauern gemeinsam: das auf dem höchsten Punkt errichtete Gotteshaus. Sonst aber, wenn ich der Klinik, des öffentlichen Parkes, besonders aber des Bades gedenke, finde ich nur wenig Gemeinsames.
Sitzt man im Wirtshaus beim Mittagessen, ergibt sich doch wieder Ähnlichkeit. Denn da gesellt sich der {57} eine oder andere Dorfbewohner zu dir, ein Hand-werker oder ein Bauer, kann auch sein, er führt das Gespräch vom Nebentisch herüber, und er verlangt zu wissen, wer man ist, woher man kommt und so weiter. Aber es ist so unwichtig, wer ich bin, so un-interessant, woher ich komme, dafür so wichtig, wer dieser Dorfbewohner ist und so interessant, woher er einst gekommen war. Dieser Mann, der da bestaubt und gemächlich sitzt, um mich auszufragen, ist älter als Rischon le Zion, das Dorf, das gegen zwei- oder vierundvierzig Jahre zählt. Der Mann aber ist sechzig. Also, er kam aus Rußland; ein Knabe, gerettet aus dem Blutbad irgendeines Pogroms. Seither hat er hier ge-lebt, ein Leben der Arbeit, der Entbehrung, der Sorge, aber nicht gepeinigt vom drohenden Mord. War's auch manchmal unruhig, es ging nie ans Leben oder doch beinahe niemals. Man hatte so viel Sicherheit wie die anderen, man durfte sich zur Wehr setzen und man war jedenfalls im Lande der Väter, 'daheim". Immer wieder ist es dasselbe Lied. Diese Schicksale sind eins dem andern ähnlich und sie sind allzusammen das Schicksal des jüdischen Volkes.
Auch in Rischon ist es wie in anderen, alten Kolo-nien begegnet, daß die Söhne der ursprünglichen An-siedler wieder in die Fremde zogen, nach Europa zurück, nach Amerika, Australien oder ins Kapland. Nicht alle Söhne freilich, aber doch genug, um sagen zu können, die Ansiedler hätten nicht Wurzel gefaßt. Je öfter ich diese Tatsache konstatieren höre, desto weniger Eindruck übt sie mir. In vielen anderen {58} Ländern geschieht dasselbe häufig genug: die zweite Ge-neration verläßt die Kolonie, die von den Vätern ge-gründet wurde. Weil das Bebauen des Bodens zu schwierig ist und der Ertrag die harte Arbeit nicht lohnt. Weil die Zustände des besiedelten Gebietes, an mangelnder Sicherheit, an fehlenden Verkehrsmitteln der Entwicklung zu viele Hindernisse schaffen. An solchen Dingen hat, wie oft, das beste Bauernblut schon versagt.
Hier in Palästina sind die Sicherheitsverhältnisse unter der Türkenherrschaft so schwankend gewesen, daß ihnen bis heute noch eine endgültige Festigkeit nicht beizubringen war, und die Verkehrsmittel lagen gänzlich in primitiven Anfängen. Das verminderte den Ertrag, der nur durch schwere Arbeit dem Boden ab-gerungen werden kann.
Die heute ins Land kommen, um da zu bleiben, urteilen wohl zu streng über die alten Kolonisten und deren Söhne. Denn sie kommen heute getrieben und ge-tragen von einer großen Idee, der die Kraft einer Reli-gion innewohnt. Sie kommen, jedes Schiff, das neue Ansiedler bringt, als Kolonnen einer Arbeiter-Armee, deren Aufmarsch erst begonnen hat, und noch viele Jahre, wahrscheinlich Dezennien, andauern mag. Der Horizont ihres Wirkens ist nicht beschränkt durch die Grenzen ihres Ackers, der ihnen zugewiesen wird; er umfaßt das ganze Land der Verheißung, mit einem ungeheuren kühnen Arbeitsplan, hundertfach ge-gliedert, hundertfach veränderlich und ständig erweitert. Jeder einzelne ist hier diesem Plane eingefügt, {59} ist ein Teil davon, ein tätig schwingendes Rad der großen Maschine, und alle Juden der Welt, siebzehn Millionen Menschen, sind dem großen Vorhaben, das Land der Verheißung in das Land der Erfüllung zu wandeln, unauflöslich verknüpft. Das ergibt eine andere Situation, innerlich und äußerlich, ideell, mo-ralisch und praktisch, als die Lage, in der sich die ersten Kolonisten vor einem halben Jahrhundert be-fanden, die ihr Hiersein nur der Wohltätigkeit zu danken hatten.
Es ist eine merkwürdige Sache um die Wohltätig-keit. Sie bringt Segen, heißt es, doch selbst das Bibel-wort wagt nur die Behauptung, daß sie denjenigen Segen bringe, die Wohltaten üben. Von den Unglück-lichen jedoch, die Wohltaten empfangen müssen, ist nirgends ausführlich die Rede. Offenbar will sich keiner so recht darauf einlassen, diese heikle Ange-legenheit näher zu untersuchen. Seit die menschliche Gesellschaft besteht, ist das Wohltun, ist das Almosen-geben nur ein lächerlich schwaches Korrektivmittel, das Unrecht der sozialen Ordnung zu mildern. Selbst der liebe Gott hat kein besseres Mittel gefunden. Er befiehlt, er bittet, er verspricht ewigen Lohn, aber wie viele sich auch beeilen, dem göttlichen Gebot gehor-sam zu sein, wie viel auch geholfen wird, niemals ist eine wirkliche Hilfe draus geworden. Alle geben, der Talentvolle dem Talentlosen, der Hervorragende dem Unbedeutenden, der glückliche Erbe dem Stiefsohn des Glückes, dem kein Erbteil zufiel, der Reiche dem Ar-men. Sicherlich, in tausend Fällen gibt der Gute dem {60} Besseren, in tausend Fällen sogar der Schlechte dein Guten.
Aber wie viel auch gegeben wird, noch nie schwand die Armut aus der Welt, und ich kann es nicht leugnen, das ist deine Schuld, du mein Gott, der du der Gute bist und ebenso gewiß der Einzige, der die soziale Frage lösen könnte. Bei aller Ehrfurcht vor dir und bei aller Liebe zu dir, mein Gott, es ist deine Schuld. Ja, noch mehr. Du hast durch dein Gebot des Wohltuns das Gewissen der Mächtigen und Reichen eingelullt, den Sinn der Armen umnebelt, und soweit eine soziale Gerechtigkeit auf Erden überhaupt denk-bar ist, hast du ihr Walten so lang wie nur möglich hinausgezögert.
Zum Wesen der Wohltätigkeit gehört es, daß ihr der Dank, den sie oftmals verdient, niemals gezollt wird. Es ist schön, daß der Baron Rothschild die Kolonie Rischon le Zion und noch andere Siedlungen mit seinem Geld gegründet und dauernd gestützt hat. Aber weder Dank, noch Bewunderung gebührt ihm dafür. Man kann eben nicht der Baron Rothschild sein, wäh-rend in Rumänien und Rußland arme Juden geplün-dert, mißhandelt und ermordet werden. Man kann das als Rothschild nicht miterleben und ruhig in seinem Pariser Palais des Daseins sich freuen, als sei nichts geschehen. Man muß etwas tun, um sich den Schlaf der Nächte wieder zu kaufen.
So sind die ersten Ansiedler nach Rischon le Zion gelangt, armseliges Menschheitsgestrüpp, von nieder-trächtigen Händen aus armseligem Ghettoboden ge-rauft, und durch Wohltätigkeit der heiligen Erde {61} Palästinas eingepflanzt. Ein edles Werk. Doch es voll-zog sich nach so unzulänglichem Gesetz, daß weder dem Gesetz, noch seinem zufälligen Vollstrecker dafür zu danken bleibt.
Jetzt wird auch dieses große Bauerndorf vom neuen Geist der Allgemeinheit, vom neuen Willen des ganzen jüdischen Volkes langsam durchdrungen und jetzt erst beginnt Rischon le Zion tiefer in der Erde zu wurzeln, sicherer in der Scholle zu ruhen. Hier hat der Wein-bau geblüht und würde immer weiter, immer reicher gedeihen, wenn die Welt noch so viel trinken würde wie früher. Aber seit die Sowjets in Rußland regieren, hat dieses Reich aufgehört, ein Absatzgebiet zu sein. Und seit sie in den Vereinigten Staaten die Prohibi-tion haben, ist auch diese Kundschaft verloren ge-gangen. Nun liegen in den Kellereien von Rischon le Zion herrliche Weine in riesigen Mengen und finden keinen Käufer, finden nicht mehr so viel Käufer, daß der Weinbau im früheren Umfang ferner noch loh-nend wäre.
Der Küfer, der mich durch die Keller führt, ist ein schmächtiger alter Jude, er hat ein schmales, feines Gesicht, das durch den dünnen, silbergrauen Bart nur noch schmäler wird. Seine sanften, rehbraunen Augen sind voll Ergebenheit, und seine Reden haben jene er-gebene Höflichkeit, in der das Persönliche dennoch im Unnahbaren gehalten und gewahrt wird.
Man trifft hierzulande bei vielen Juden, besonders bei den älteren Männern diesen Ton, der so angenehm {62} wirkt, weil er so erbötig ist, ohne sich dabei das Geringste zu vergeben.
Der Küfer zeigt mir die ungeheuren Fässer, die voll alten Kognaks daliegen, voll Chartreuse und Benedik-tiner-ähnlichem Likör. Er zeigt mir die Weinbehälter im Keller, die viele Hektoliter fassen an schwerem alten Süßwein, roten, der wie Bordeaux oder Madeira oder wie Tokaier schmeckt, und weißen, der an Haute Sauterne und an manche Rheinweinsorten erinnert. Diese Behälter sind aus Beton und inwendig mit dicken, großen Glasplatten ausgelegt, und sie können von innen beleuchtet werden. Er zeigt das Schlauch-system, das die Füllung der zum Abtransport bestimm-ten Fässer ermöglicht, die Maschinen, die zur Be-reitung der Trauben, zum Keltern, dienen, zum Be-treiben und Beobachten der Gärung, endlich die Böttcherei, das chemische Laboratorium, die Werk-stätte und die Mühle. Alles ist so vollendet und so mu-sterhaft, wie nur in irgend einem europäischen Groß-betrieb.
Unterwegs erzähle ich ihm von den Memoiren des Fürsten Urussow und von der Anerkennung, die er den jüdischen Weinbauern in der Ukraine gezollt hat. Der alte Jude hört aufmerksam zu, mit bewegungs-losen Mienen. Dann lächelt er nur. Aber dieses Lächeln löscht den Fürsten Urussow, löscht die ganze fürstliche Anerkennung weg; so leicht und so rasch, wie man ein wenig Staub vom Rockärmel bläst.
Er begreift die Prohibition in Amerika, und er Be-greift auch, wie gut es ist, wenn die Menschen wenig {63} oder gar keinen Wein trinken; es tut ihm nur leid, daß eine Sache gut genannt werden muß, die dem Betrieb hier Schaden bringt. Man wird von nun an den Tabakbau pflegen. Alle Menschen rauchen Tabak, die Moslims wie die Christen, die Amerikaner wie die Europäer, es gibt also keine Absatzschwierigkeiten. Dennoch ist der Tabak ebenso schädlich wie der Wein, vielleicht noch schädlicher, weil ja das starke Rauchen viel mehr verbreitet ist als das unmäßige Saufen. Aber man darf der Menschheit nicht alle Gifte ent-ziehen, wenigstens nicht alle auf einmal.
Und so kann einstweilen noch Tabak gebaut werden.
{64}
VII
Wir kommen von Nazareth herunter, auf der schönen alten Straße, die nach Nablus führt und ver-lassen sie um ostwärts den Feldweg zu nehmen in die Ebene, die sich von da bis an den Jordan erstreckt. Anmutig stilles Gelände, Weidegründe, grüne Flächen, die wieder Felder werden sollen. Die Gutwilligkeit der Natur wird hier überall ganz deutlich, ebenso, wie die lange Zeit, in der sie so arg vernachlässigt und mißhandelt wurde, bis sie ganz und gar in Verarmung fiel. Auch hier. Die Quellen, die von den Bergen springen, sind im Boden versickert und erstickt, der davon durchwühlt ist und Fieber atmet. Gras, Klee und wilde Blumen gedeihen üppig auf dieser über-mäßig getränkten Erde, die Reichtum geben kann statt Malaria.
Hier sind junge Kolonien. Eine neben der ändern. Hier werden in einigen Jahren noch mehr Kolonien entstehen und das ganze Emek wird jüdisch sein.
Die Arbeit beginnt hier beim Uranfang, von der Mühseligkeit, den Boden erst einmal zu bereiten, die versumpften Fluren zu entwässern, die Scholle herzu-richten, daß sie Saat empfangen und Ernte tragen kann.
{65} Auf diesem Weg, der grasüberwachsen ist, den man oft verliert und nur nach den tief in die nasse Erde ge-rissenen Radspuren wieder findet, leistet der Wagen-lenker Unglaubliches. Das Auto tanzt und stolpert und schaukelt und droht, jeden Moment auseinander zu bersten. Aber es hält brav zusammen, und Chaim Mandelbaum sitzt am Volant neben mir und macht ein so ruhiges, vergnügtes Gesicht, als fahre er über einen asphaltierten Boulevard.
Wir begegnen Reiter, schlanke, schöne Gestalten, auf schönen, feurigen Pferden. Junge Männer, die stolz im Sattel sitzen, den Karabiner über die Schulter geschnallt oder vor sich quer am Sattelknopf befestigt, den großen Browning im Gurt. Das sind die Flur-hüter. Sie haben ein schweres, an Gefahren reiches Amt. Und ich erinnere mich eines Buches, darin waren alle verzeichnet, mit ihrem Lebenslauf und ihrem Ab-bild, die im Kampf für die Sicherheit der Kolonien gefallen sind oder meuchlings ermordet wurden. Es ist ein Buch voll eines Heldentums, das umsomehr erschüttert, je selbstverständlicher und unpathetischer diese Männer dienen, dulden, kämpfen und sterben.
Knaben waren unter ihnen, rührend durch ihre ein-fache Tapferkeit, durch ihren Opferwillen und durch ihre Jugend. Männer um die Fünfzig und Sechzig, denen in Europa bei Pogromen Frauen und Kinder erschlagen worden waren. Sie zogen nach Palästina, nicht mehr fähig, die schwere Feldarbeit zu leisten, aber, wie in ihren Nerven die Erinnerung an all die hingemordeten Angehörigen wühlte, wie das Gedenken {66} jener gemeinen Überfälle in ihren Seelen brannte, fühlten sie sich entschlossen, die Siedlungen ihres Volkes im Land der Verheißung zu bewachen und mit bewaffneter Hand zu schützen.
Sie haben alle schlicht und ergeben der Stunde ent-gegengeharrt, die ihnen den Tod bringen mußte, diese Knaben und diese Männer, und sie haben ihr Leben teuer verkauft, ehe die Kugel im offenen Kampf sie streckte oder sie aus dem Hinterhalt einmal zu Boden warf. Keiner von ihnen hat an den Ruhm ge-dacht, oder an Ehre, oder wie die schönen Worte alle heißen, die so gut klingen, wenn man nachher von diesen Tragödien erzählt; keinem fiel es ein, sich einen Helden zu dünken. Denn was war es schließ-lich auch gewesen, wenn man solch einen zerschos-senen Leichnam irgendwo in aller Stille verscharrte?
Eine Rauferei armer Juden mit Arabern, die gleich-falls arm gewesen sind. Aber wenn sie hinsanken und ihr Blut die Erde netzte, die einst Urheimat ihrer Väter gewesen und Heimat ihrer Nachfahren werden sollte, war in ihren sterbenden Pulsen noch ein Wissen, daß ihr kleines Leben nicht vergeblich er-losch, daß der Bund zwischen Land und Volk, den rohe Gewalt vor vielen Jahrhunderten entzweigerissen hatte, mit jedem Blutstropfen wieder gekittet würde, daß jedes Blut, aus Todeswunden zu dieser heiligen Erde verschüttet, Wurzel schlug. Sie haben ehrwürdige Arbeit geleistet, indem sie sich darbrachten, in der Stille. Haben Humus geschaffen in diesem Land, ebenso, wie die Chaluzim, die mit ihren Händen den {67} Humus auf die nackten Berge tragen und sich zum Opfer bringen.
'Schalom!" grüßen die Flurwächter, die uns be-gegnen. Kurz, ernst und reiten vorbei. Manchmal kommt eine ganze Kavalkade. Araber sind dabei, und sie reiten, ohne Waffen, friedlich zusammen, nur an der Kleidung, selten am Typus zu unterscheiden. Söhne zweier Brüdervölker, die nur zu lange getrennt waren, um jetzt schon ganz verbrüdert zu sein. Irgend ein Grenzstreit, oder ein Geschäft führt diese arabi-schen und jüdischen Flurwächter zusammen, und sie reiten in die Kolonie, die es betrifft, zur gemeinsamen Besprechung.
'Schalóm!" rufen wir zum Dank. Es ist der alte Judengruß aus Bibeltagen. 'Friede" oder 'Friede mit dir". Die Mohammedaner sprechen: 'Salam!"
Der Gruß des Menschen, der vor dem Menschen auf der Hut sein muß! Der Wunsch des Menschen, der weiß, daß der Friede, die Güte und das Verstehen erst beginnt, wenn die Waffen ruhen. Die Sehnsucht des Menschen nach all dem Segen, nach all dem Blü-hen und Gedeihen, das nur jenseits von Gewalt an-heben kann. Die pazifistische Gesinnung eines alten Volkes, das unerhörte Siege und nie erhörte Nieder-lagen erlebt hat, spricht im lebendigen Herzen dieses Grußes: Schalom!
{68}
VIII
Ganz nah am Fuße der Gilboah Berge liegen drei Kolonien in die Ebene geschmiegt. Ain Charoth, die erste, zu der man, von der Landstraße kommend, ge-langt, dann Tel Josef, die zweite, die ein wenig kleiner ist und zuletzt Beth Alpha, die jüngste dieser Siedlungen. Jede ist eine Kwuza, das heißt ein gemein-wirtschaftlicher Betrieb. Jede ist ein Garten der Jugend, jede der Anfang eines neuen Zeitalters, und in jeder wird der Versuch einer neuen Weltordnung lebendig. Ein Versuch, ohne lautes Parteiprogramm, ohne den starren Eigensinn des Parteigeistes. Begie-riges Achten auf alles, was glückt oder mißlingt, festes Zusammenhalten, Arbeiten und die Zustände in ihrer Entwicklung ohne Zwang abrollen lassen. Das ist der Eindruck, den man empfängt.
Zuerst bin ich, der Reihe nach, in allen drei Kolonien gewesen, so wie sie daliegen, wenn man herzufährt. Dann bin ich von Beth Alpha wieder nach Tel Josef und Ain Charoth und noch einmal von Ain Charoth bis Beth Alpha. Ich gebe zu, daß ich selten im Leben so angeregt war und so in geistiger wie seelischer Alarmiertheit, daß ich selten so erfüllt gewesen bin von hundert kleinen und größeren Bedenken, aber {69} auch selten so erhoben von großen Hoffnungen, und niemals noch so begeistert von Jugend, von junger Schwungkraft, von jugendlichem Idealismus, von hoher Religiosität, wie von den jungen Menschen hier, die fast durchwegs Gottesleugner sind.
Hier befindet man sich am äußersten Vorgebirge der Gegenwart. Wie ein Kap der Guten Hoffnung liegt dies Land da im Ozean der Zukunft. Nicht bloß Palästinas Schicksal bereitet sich hier, nicht bloß das Los des jüdischen Volkes auf seiner alten Erde. Hier gehen die alten Probleme der Menschheit, Besitz und Ehe, ihrer Lösung entgegen, hier scheidet sich Konvention von Ethik und es wird nur derjenige Brauch erhalten bleiben, der aus den Geboten wahrer Sittlichkeit ent-sprang. Ganz am Rand des Kommenden wandelt man hier, und sieht das Morgen langsam zum Heute wer-den oder das Heute zum Morgen.
Diese jungen Menschen sind vor vier, vor drei Jahren noch in Europa gewesen. Mancher noch vor einem Jahr. Nur wenige von ihnen haben den Krieg hier in Palästina schon mitgemacht. Die meisten lagen an irgend einer europäischen Front im Schützengraben. Und sind nach dem Zusammenbruch fort, desillusioniert von den blödsinnigen Beschuldigungen, die als einzige Antwort und Vergeltung für die geleisteten Blutopfer kamen, angewidert von den chaotischen Zuständen, darin kein Aufschwung, an dem sie teil-nehmen konnten, das Sehnen junger Herzen erfrischte.
Als Opfervieh ins Feuer gejagt, als Sündenbock für fremde Mißerfolge behandelt, das war das Schicksal {70} ihres Volkes, war das Schicksal der meisten Einzelnen, die sich dann aufmachten, ohne Verabredung, nur dem Rufe der Idee, nur dem Drang des Herzens folgten und hierherkamen. Freiwillige eines großen Gedankens, der sie bezauberte, Vollstrecker ihres eigenen Ent-schlusses, Befreite.
Sie bauen hier Tabak und Ölbaum und Mandel, wie Orangen und Bananen. Sie säen hier Weizen und Korn. "Sie halten hier Kühe, züchten Hühner, pflegen Bienen. Das klingt idyllisch, aber es ist nichts weniger als eine Idylle. Es ist angespannte, heiße Arbeit, Kampf mit dem Boden, mit den Tücken des Fiebers, mit sich selbst.
Andere Bauern sind von Geburt an Bauern; sie haben nichts anderes gesehen, nichts anderes gelernt. Ihnen leben Kenntnis, Geschicklichkeit, Instinkt des Bauernberufes als feste Atavismen von Eltern und Voreltern her im Blut. Den Boden, den sie erben, haben sie als Kinder schon gekannt, haben als kleine Jungens oder Mädels die ersten Handgriffe gelernt, die er verlangt, und die Scholle ist ihnen durch die Arbeit von Generationen vorbereitet, wenn sie eines Tages selber als Besitzer zur Arbeit antreten.
Diese jungen Menschen da haben dagegen vor wenigen Jahren noch in großen Städten gelebt, die meisten von ihnen haben auf Universitäten studiert, haben die Existenz Zigaretten rauchender Intelligenzler geführt. Eines Tages sind sie hier gelandet, um ein neues Leben zu beginnen. Die Arbeit, die da ihrer wartet, fällt hart, weil sie nicht gewohnt ist und {71} sie wird zehnfach hart, weil die Erde nicht be-reitet ist.
Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Bauern, die ihr Tagwerk da fortsetzen, wo der Vater aufgehört hat, und den Menschen, die erst Bauern werden müssen, auf einer Erde, die erst Acker werden soll.
Die jungen Menschen, die nun hier Landwirtschaft treiben, haben eine Zeit hinter sich, in der sie sich er-probten. Sie waren Taglöhner, als sie ins Land kamen. Zu schroff ist die Umstellung, vom Städter zum Bauern, vom europäischen Deutschen, Polen, Rumänen zum Bewohner Palästinas, von geistiger Beschäftigung zu körperlicher Arbeit. In dieser Wandlung, die durch-greifend ist, wie keine, kann der von einer großen Idee noch so hoch gesteigerte Wille leicht zusammen-brechen. Eine erhabene Idee, von der die Seele, be-sonders aber die jugendliche Seele hingerissen wird, kann den von ihr Ergriffenen, manchmal in seinem Urteil über sich selbst verwirren, über seine Eignung, seine Gesundheit, seine Ausdauer, seine Kraft. Deshalb werden die jungen Menschen, die hier einwandern, vorerst zu den harten Taglöhnerarbeiten verwendet. Sie sind schon Auswahl, diejenigen, die nach Palä-stina kommen, um den Boden zu bebauen. Sie wissen, was hier auf sie wartet, und nur die Besten unter den Guten, nur die Gediegensten unter den Tüchtigen ent-schließen sich dazu.
Aber, wenn sie hier eintreffen, werden sie noch einmal gesiebt. Man beschäftigt sie beim Straßenbau und läßt sie Steine klopfen, man {72} läßt sie nassen Wiesengrund drainieren, sie müssen beim Häuserbau Maurerdienst verrichten, sechs Monate, ein Jahr, oft sogar länger, bis sie angesiedelt werden.
Daß einer niederbricht in seinem Sinn oder in seiner Kraft und wieder zurück, nach Europa will, kommt natürlich vor. Doch nur selten, nur in vereinzelten Fällen.
Die jungen Siedler aber haben die Gehobenheit der-jenigen, die eine Prüfung bestanden und etwas er-reicht haben. Sie sind schon in einem höheren Sta-dium, sind mit ihrer Aufgabe im Reinen, sind es mit sich selbst und mit ihrer Kameradschaft. So viel aus-geglichene, nervenruhige, heitere und freie junge Men-schen habe ich nicht oft auf einem Fleck beisammen gesehen, wie hier, in allen Ansiedlungen.
Ain Charoth ist eine schöne, große Farm. Auf der höchsten Bodenwelle der Ebene, die hier schon sacht zu den Gilboa-Bergen anschwillt, liegen die Ställe. Ein paar Dutzend Kühe sind darin, syrische und hollän-dische; ein gewaltiger Stier, Zugpferde, Maultiere und Esel. Daran schließt der Schuppen für die Wagen und nebenan die Schmiede. Es ist eine lange Front, die ein weiträumiger Hof gegen das Gebirge abschließt. Dann sind noch die Schuppen da für Getreide und Vorräte. Auf der anderen Seite des Hofes steht der Speisesaal für alle, verbunden mit der Küche, in der für alle ge-kocht wird. Dann ist noch das Haus, in dem die Säug-linge gepflegt werden, dann ein kleines Spital für Kranke, mit einem Zimmer für die ärztliche {73} Ordination. Eine kleine Gasse trennt die Hütten der Ansiedler von diesen offiziellen Gebäuden. Fast alle sind aus Beton und Brettern. Die Ställe aus dem besten Mate-rial, Ziegel und Beton, die Wohnhütten aus Brettern zusammengenagelt. Aber viele, sehr viele kampieren noch in Zelten.
Diese Einrichtung! Unter freiem Himmel, unter diesem südlich blauen Firmament, das von kleinen, zarten, weißen Schafwölkchen überhaucht, von einer sengenden Sonne überfunkelt ist, wird alles schön und leicht und reich. In dieser Luft, die den Duft der Felder trägt, den süßen Geruch der Bananen, und die tiefen, mühelosen Atemzüge der Freiheit, scheint alles nur Kinderspiel und Jugendsport. Hier draußen, wo der Blick ungehindert ins Weite fliegt, die grüne Ebene entlang, zu den Bergen Galiläas hinüber, hier draußen ist Hoffnung und Erwartung des Guten. In der engen Umschlossenheit der Hüttenkammer, in der flattern-den Umkleidung des Zeltes jedoch, die 'einstweilen" sagt und Monate, vielleicht Jahre dauert, steht man immer wieder erschüttert. Äußerste Dürftigkeit, die sich streng auch des Letzten noch entdürftigt.
Ein Feldbett, eine Waschschüssel, eine kleine Petroleum-lampe ... und Bücher. Sonst nichts. Ein bißchen Wäsche liegt geordnet auf offenem Schrägen, die paar Kleidungsstücke hängen bloß an der Wand. Der Fuß-boden in den Zelten, ebenso wie in den Hütten, ist die nackte Erde. Gebretterte Böden gibt es nur in der Küche, im Speiseraum, im Spital und bei den Kindern. Hier, in der Enge und Strenge dieser Zelte, dieser {74} Hütten, ist die Zelle der Entschlußkraft, hier verwirk-licht sich Begeisterung für eine Sache zu harter Sach-lichkeit. Hier geht das Opfer, das der Anfang erfor-dert, andauernd vor sich, stündlich, täglich, bei Tag und Nacht, bei Sonnenschein und Regen, bei Hitze und Kälte. Hier ist der Anfang selbst, klein, arm-selig, mühsam, und unendlich hoch darüber, fast un-sichtbar, nur in Träumen erschaut, schwebt das Ziel, das erreicht werden muß, das andere einst erreichen werden.
In diesen Zelten habe ich die Essays von Montaigne gefunden, die 'Geschichte der Zivilisation in England" von Buckle, 'Die Entstehung des modernen Frankreich" von Taine, 'Das Kapital" von Marx. In diesen Hütten habe ich das Violinkonzert von Mendelssohn spielen gehört, Kompositionen von Beethoven, von Brahms, von Rachmaninow. Und ich sah Bilder an die kahlen Wände geheftet, aus Zeit-schriften geschnittene Reproduktionen nach Tizian und Rembrandt ebenso wie nach Cezanne und Vin-cent van Gogh. Wenn ich dann wieder ins Freie trat, aufgewühlt von dem Eindruck, den das Leben dieser jungen Menschen in mir hervorstürmte, wenn es mir in die Seele schlug, wie nah diese jungen Menschen allem Geistigen und Kulturellen sind, und wie fern von den Zentren der Kultur sie hier dem heiligen Bodan sich verwurzeln, wie harmonisch, wie selbstverständ-lich sie dies Doppelwesen, dies Übergangswesen ver-einigen, wie bescheiden, wie genügsam, dann fiel mir ein Wort aus der Bibel in den Sinn: 'Wie schön sind deine Zelte, o Jakob, wie herrlich deine Wohnung, o Israel !"
{75} Unter den jungen Leuten, die abwechselnd mit mir gehen, ist einer, der mich besonders anzieht. Ein dünner, hübsch gewachsener Mensch, mit einem Ge-sicht, das an Voltaire erinnert, mit Augen, welche die ganze Welt auszulachen scheinen und mit einem dünnlippigen, beweglichen Mund, um dessen charakte-ristische Schwunglinie Klugheit schwebt und Sarkasmus. Da ich zu den Kindern eintreten will, hält er mich zurück.
'Nicht viel zu sehen, da drinnen." Und er lächelt ironisch. 'Säuglinge ... Kleine, die in der Wiege liegen ... ist Ihnen das so wichtig?" Statt aller Antwort folge ich ihm vor das Haus auf die Bank. Ich kann ja später zu den Kindern. Wir rauchen und ich beginne mit ihm das Spiel einer Diskussion; ich vertrete Anschauungen, die gar nicht die meinigen sind, nehme bald den einen, bald den andern Stand-punkt ein, auf dem ich gar nicht stehe und von dem ich weiß, daß er gar nicht hierhergehört. 'Sie mögen Kinder nicht...?" frage ich ihn. Der junge Mann kneift die Augen ein und blinzelt mich erschreckt an. 'Wenn ich ein Kind haben werde," sagte er langsam, 'werde ich es mögen ..."
'Sie werden es hierhergeben, in die Anstalt?"
'Selbstverständlich ..."
'Gehört das Kind nicht zu seiner Mutter?"
Er lächelt überlegen: 'Nicht jede Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist eine Mutter." Er deutet mit einer Kopfbewegung in das Haus, vor dem wir sitzen.
{76} 'Die da drinnen, die sich Tag und Nacht damit be-fassen, die Säuglinge zu pflegen, das sind Mütter. Aber es hat noch keine von ihnen ein Kind gehabt."
'Und die Mütter dieser Kinder da, die kümmern sich gar nicht um die Kleinen?"
In dem Blick, mit dem er mich ansieht, lese ich amüsiert, für wie dumm er mich hält. Dann sagt er:
'Natürlich kommen sie her zu ihren Kindern, wenn sie mit der Arbeit fertig sind." Er schaut mich mit-leidig, spöttisch an und fügt hinzu: 'Auch die Väter kommen."
Ich schweige. Er wird hart in seinen Zügen und sagt laut: 'Unsinn!"
'Was meinen Sie?" erkundige ich mich.
'Daß die Kinder zu ihren Eltern gehören!" entfährt es ihm.
'Haben Sie Eltern?" frage ich ruhig.
Er wird wieder heiter und ironisch. Seine Augen schauen mich fröhlich lachend an. 'Nicht von Ge-fühlen ist hier die Rede, nicht von Sentimentalitäten. Ein neuer Zustand unter den Menschen muß ge-schaffen werden, ein höherer. Der alte Zustand taugt nichts."
'Wollen Sie damit beginnen, Vater und Mutter ab-zuschaffen?"
'Warum nicht?" antwortete er mit rascher Keck-heit. 'Hier hat jedes Kind viele Mütter..."
'Und viele Väter", ergänzte ich. Er sieht mich an, merkt, daß ich spasse und wir lachen beide.
{77} Dann wird er ernster und erklärt: 'Ich will sagen, wir alle sind hier eine einzige, große Familie."
'Kommunismus ...?" werfe ich ein. "
Er zuckt die Achsel, 'Man kann es nennen, wie man will... es ist die Zukunft."
'Wie herrlich," bemerke ich, 'daß man nur jung sein braucht, um die Zukunft zu kennen."
Ohne Zögern erwidert er: 'Ich behaupte nicht, daß ich die Zukunft kenne, aber ich glaube an die Zu-kunft." Und nach einer Sekundenpause, leiser: 'Wäre ich sonst hier . ..?"
Wir sprechen vom Eigentum, das er nur in ganz schmalen Grenzen gelten läßt; von Ausbeutern, als die er alle betrachtet, die 'andere für sich arbeiten lassen". Doch er gibt zu, daß manche dieser Ausbeuter schwerer arbeiten und andauernder, als irgend einer von ihren Lohnsklaven. Da er aber auch noch zu-geben soll, daß etliche von denen, die unter seinen Begriff von Ausbeutern fallen, mit ihrer Leistung doch eigentlich für viele andere arbeiten, deren Existenz sie erst geschaffen und ermöglicht haben, wehrt er sich. Er springt auf, geht ein paar Schritte fort, und wie er wieder zurückkehrt, ist alle Ironie, alles Fröh-liche aus seinem Antlitz weggewischt; nur Fanatismus steht mit harten Zügen drauf gemeißelt. 'Diese ganze Weltordnung ist schief", sagt er leise und verbissen.
'Sicherlich," bekräftige ich, 'schief, falsch und un-gerecht."
Er sieht mich an; seine Augen lachen wieder, {78} ehrlich und jung. Das: 'Ja!" klingt kurz, scharf und erledigend.
'Aber auch in der Natur," füge ich nicht ohne Pro-vokation hinzu, 'auch in der Natur ist vieles un-gerecht."
Ganz bestürzt ruht sein Blick auf mir: 'Meinen Sie das im Ernst?" Als ob er fragen wollte: Merkst Du nicht, wie Du Dich blamierst?
'Ich meine," sagte ich, 'wir können diese mensch-liche Weltordnung weiter und höher bringen. Sie ist ja schon ein wenig weiter und höher gekommen gegen früher. Wir können und wir müssen sie veredeln, so gut wie möglich. Aber gegen die naturgewollten Dinge sind Verbesserungen unmöglich."
Sein Gesicht spielt wieder in ironischen Mienen. 'Diphtherie", ruft er aus, 'gehört zu den natur-gewollten Dingen ... nun? Man heilt sie!"
Ach, wie überlegen ist dieser junge Mensch, wie hübsch sieht er aus in seiner ironischen Klugheit, und wie zerarbeitet sind seine mageren, feinen Hände.
'Gewiß", stimme ich zu. 'Sie dürfen auch sagen, es gehöre zu den naturgewollten Dingen, daß ein Zahn kariös wird ... nun, man plombiert ihn ganz einfach."
'Also ... man kann die Natur verändern!" sagt er mit einer Gebärde, die 'erledigt" heißt.
Aber mir scheint die Sache nicht erledigt. Ich setze die Diskussion fort. 'Das sind keine Beispiele für unser Thema, weder die Diphtherie, noch der hohle Zahn, noch sonst etwas von dieser Art. Wenn Sie den Ackergrund dort unten drainiert haben, so daß er nicht {79} mehr sumpfig ist und keine Fieberdünste mehr atmet, können Sie ebenso behaupten, Sie hätten die Natur verändert!"
Er lacht: 'Haben wir auch!"
'Sie haben nur", fahre ich fort, 'natürliche Pro-zesse in ihrem Verlauf zu menschlichem Vorteil ge-lenkt. Gegen Bakterien hat man ein Serum gefunden, das die Bakterien vernichtet. Den kariösen Zahn bohrt man aus, verschließt ihn luftdicht und er bleibt Jahre lang erhalten. Dem zum Sumpf gesammelten Wasser wird ein Abzug gegraben ... das alles ist verstandene, erforschte, in ihren Geheimnissen belauschte Natur, aber immer doch Natur."
Er fragt: 'Nun . .. und .. .?"
'Die Natur des Menschen kann verbessert, veredelt werden, aber nicht verändert! Der Eigentumsinn ist den Menschen natürlich, der Familiensinn sitzt ihnen im Blut. Es ist natürlich, daß es Begabte und Talent-lose gibt, Wertvolle und Wertlose. Es gibt ein naturgewolltes Proletariat. Jede Revolution, die sich gegen das Unumstößliche wendet, muß scheitern."
Seine Augen glühen. 'Das ist Bürgermoral," flüsterte er mit zuckenden Lippen, 'das muß ausgerottet werden."
'Lieber, die Bürgermoral ist schlecht, das gebe ich Ihnen zu. Aber welche Moral, als Moral einer Klasse steht höher? An der Pyramide der Gesellschaft ist vieles, was ganz oben sitzt, kernfaul, und vieles, was ganz unten liegt, ist es erst recht."
{80} 'Deshalb muß sie vom Grund aus umgestürzt wer-den, diese Pyramide!" sprudelt er.
'Bravo!" rufe ich. 'Ausgezeichnet! Solche Umstürze sind notwendig und ein Gebot der Ethik. Sie müssen sich vollziehen und sie vollziehen sich, sei es durch Evolution oder durch Revolution. Es wäre nur zu be-merken, daß die Evolution der Revolution immer weit voraus ist. Die Revolutionsführer meinen immer, sie hätten durch die Gewalt ihres Ansturmes den Riesenbaum, der dem Volk Licht und Sonne nahm, zum Splittern gebracht, indessen ist er von der Ent-wicklung längst schon durchsägt worden und ein Fuß-tritt konnte ihn fällen. Lange vor 1789 waren die großen Befreier Voltaire und Rousseau, aber Robes-pierre und Marat und die anderen sind kleine Leute gewesen."
Er sieht mich an: 'Dennoch waren sie groß an ihrem Platz", spricht er ruhiger.
'Mag sein," gebe ich Antwort, 'aber vergessen Sie nicht, Revolutionen machen nur diejenigen, die schon befreit sind; der wirklich Unterdrückte macht keine. Und nach 1789 hat sich die alte Gesellschaftspyramide mit einigen, allerdings wichtigen Veränderungen wieder hergestellt..."
Er lacht und sagt wegwerfend: 'Ja ... weil es eine bürgerliche Revolution gewesen ist."
'Nein," falle ich ihm ins Wort, 'weil sich diese Pyramide immer wieder herstellen wird. Nach Ge-setzen, die in der Menschennatur walten. Das wissen auch die Führer und die führenden Geister der {81} proletarischen Revolution. Sie sagen es nicht, weil kein Massenführer, am wenigsten ein Anführer im Um-sturz, alles sagen kann. Mag sein, etliche wissen es nicht, oder sie wollen es nicht wissen, dann erfahren sie es, wenn sie darangehen, den Staat nach ihren Theorien aufzubauen. Allerdings, das ist dann ihre bitterste Erfahrung. Es gibt Dinge, die durch keinen Terror aus dem menschlichen Wesen zu tilgen sind. Vor allem die Selbstsucht."
Er fährt auf: 'Die muß sich im Gefühl für die Allgemeinheit lösen."
Ich beschwichtige ihn: 'Möglich, daß ihr Grenzen gezogen werden, sicherlich sogar kann sie beschränkt werden auf ein Maß, das nicht so sehr gemeinschädlich wäre; aber es bleibt undenkbar, sie auszurotten. Man kann gewiß auch die Geschlechtsmoral 'ent-bürgerlichen', wenn Sie wollen! Sagen wir lieber, 'ver-menschlichen'. Aber Mutter, Vater und Kinder bilden eine Einheit, die Keimzelle der menschlichen Gesell-schaft. Auf dieser Einheit beruht alle Leistung der Menschheit, alles was sie bindet und aufbaut, von An-fang an. Und diese Einheit wird die Gesetze der Ge-schlechtsmoral immer wieder bestimmen, immer wieder und wieder. Niemals kommen Theorien oder Programme oder abstrakte Prinzipien dagegen auf, terroristische Erlässe schon gar nicht. Dann noch der Unterschied, den die Natur zwischen Mensch und Mensch legt. Machen Sie alle gleich; ekrasieren Sie alles, was nur um Millimeterbreite über den Durch-schnitt der Masse reicht, und augenblicklich wird die {82} Natur wieder ihre unbesiegbare, ihre durch nichts zu erschütternde Arbeit beginnen und eine neue Pyra-mide formen, aber ihr Entstehen ist nicht zu hindern und unausbleiblich."
Er schüttelt den Kopf: 'Nein! Es darf keinen Ab-stand geben, zwischen Mensch und Mensch!"
'0h!" rufe ich aus, 'oh, man würde in der besten aller Welten leben, wenn nur der Abstand zwischen Tüchtigen und Untüchtigen vorhanden wäre, zwischen Fleiß und Trägheit, zwischen Genie und Alltags-mensch, zwischen Führernatur und Masse. Möge der Abstand noch so sehr verdeckt und gemildert sein, so bleibt doch immer ein Abstand und er ist..."
' ... naturgewollt", lächelt er.
'Also ungerecht im Grunde", schließe ich das Ge-spräch.
{83}
IX
Unweit von Ain Charoth liegt Tel Josef. Man fährt auf einem Feldweg hin, der grasbewachsen ist, immer zwischen Äckern, Bananengärten und Tabakpflan-zungen. Beständig geht es am Fuß der Berge entlang, die in großen, grünkahlen Wölbungen aufsteigen. Der Blick schwimmt voraus durch die liebliche Weite des Tales. Reiter begegnen uns. 'Schalóm!"
Der eine ist der Arzt, der hier seine Runde macht, von Kolonie zu Kolonie. Selbstverständlich sucht er auch Araber heim, wenn sein Beistand angerufen -wird. Zwei andere Reiter sind Flurwächter. Schlanke, kraftvolle Gestalten, sitzen gut zu Pferd, haben den Karabiner quer vor sich am Sattelknopf, und machen ernste, gleichmütig verschlossene Gesichter, wie man sie überall in der Welt an Gendarmen kennt.
Nach einer Weile huscht etwas über den Weg. Ein Hund? Dann sehe ich im Vorbeifahren, es ist ein Schakal. Er hat sich neugierig herumgedreht, hält still im hohen Gras, so daß nur seine spitze Schnauze und seine gespitzten Lauscher hervorschauen. Ein paar Sekunden, während wir fahren, erspähe ich das kluge, bekümmerte Gesicht, mit dem er uns betrachtet.
Auch Tel Josef ist eine der Kolonie mit {84}Gemeinwirtschaftsbetrieb. Alles blinkt vor Sauberkeit. Die Ställe, das Vieh, die Geräte, die niederen kleinen Bretterhäuser und die Menschen. Lauter junge, meist hübsche, durchaus stramme Leute. Jünglinge und Mädchen. Alle radikal. So ziemlich die radikalste Jugend in Palästina.
Dem Hauptmann Josef Trumpeldoor zu Ehren trägt Tel Josef seinen Namen.
Trumpeldoor gehört zu den Heldengestalten des Landes. Er war russischer Staatsbürger, hat den Krieg gegen Japan mitgemacht, und dabei einen Arm ver-loren. Trotz seinem Judentum wurde er Offizier in der Armee des Zaren, bekam sogar einen Orden. Nach-her trat er in englische Dienste, focht, einarmig, im Kampf um Palästina mit und wurde Capitain (Hauptmann). Als dann der Krieg zu Ende war, blieb Trum-peldoor als Kolonist im Lande. Hoch oben, in einer der nördlichsten Siedlungen, schon nahe der neuge-zogenen syrischen Grenze, in Tel Chai, starb Capitain Trumpeldoor nach stundenlanger, heroischer Ver-teidigung gegen vielhundertfache Übermacht unter den Kugeln der Araber.
Tapferer Trumpeldoor! Sein Leben hört sich an wie eine Ballade. Kühn, einfach und groß. Dieses Leben prägt sich jedem, der davon hört, unlöschbar ein mit der Kraft seiner starken, rechtschaffenen Menschlich-keit und seines blutigen Schicksals. Ein Araber hat das Ende Trumpeldoors, dieses stundenlange, hoff-nungslose Feuergefecht gegen übermächtige Feinde, dieses ruhige, selbstverständliche Ausharren auf {85} verlorenem Posten und dieses mutige Sterben zu einem Drama gestaltet. Ein primitives Theaterstück. Aber die Sehnsucht nach Verstehen, der Trieb, diejenigen zu verbrüdern, die im Grunde Brüder sind, die Menschlich-keit und die naive Bewunderung, mit der Trumpel-doors Gestalt angeschaut, mit der sie gezeichnet ist, machen das Werk poetisch.
( ldn-knigi: siehe auf unserer Webseite: Israel Zwi Kanner 'Josef Trumpeldor - ein jüdischer Held' Verl. Josef Belf, Wien - 1936; Joseph Trumpeldor 'Tagebücher und Briefe' Jüdischer Verlag, Berlin, 1925)
Asis Domet hat es ge-schrieben, ein Araber und ein Christ. So merkwürdige Erscheinungen zeitigt eine große Idee. So spritzen ihre Wirkungen von Einzelmenschen ins Zu-künftige und zeigen an Beispielen, die heute noch ver-blüffend und selten sind, wie an Asis Domet, was jetzt nur ein Menschheitstraum ist, was später aber Er-füllung werden kann. Verbrüderung der Araber und Juden, Verstehen zwischen Juden und Christen. Wenigstens nur vorläufig auf dem Boden von Palä-stina.
Asis Domet kämpft für die jüdische Sache, in Wort und Schrift, in Reden und Agitationen und in Dich-tungen, wie einst Börries von Münchhausen Juden-balladen geschrieben hat. Wir trafen uns nicht in Palä-stina, Asis Domet und ich. Es wollte nicht so recht klappen. Aber in Wien kam er zu mir. Ein breiter, dicker Araber, stiernackig, mit dem Körper und den turbulenten Gebärden eines Gewalttätigen, mit einem schönen, adeligen, freilich etwas fetten Gesicht voll Energie und mit den dunkeln, gutmütigen Augen eines Kindes, mit dem herzlichen Lachen eines gesunden Schuljungen. Er stammt aus einer uralten syrischen Familie, die, wie er sagt, schon zur Zeit der {86} Kreuzfahrer das Christentum angenommen hat. Die ausge-dehnten Güter der Familie sind zum Teil verloren-gegangen. Aber Asis Domet ist unabhängig genug, sich ganz seiner Schriftstellerei, und ganz der Sache des Judentums zu widmen, er, der ein Araber ist und ein Christ.
Von ungefähr denke ich daran, daß alle Hunde die gedankenlose Gewohnheit haben, über Katzen herzu-fahren, obgleich oder vielleicht, weil sie doch beide, Hunde ebenso wie Katzen, dem gleichen Gott, das ist dem Menschen, ergeben sind. Aber wo ein Hund nur immer eine Katze erblickt, sofort stürzt er wie ein Irr-sinniger über sie her, wie in einem plötzlichen Anfall von Tobsucht, und würgt sie ab... wenn er nur kann. Er mag nun ein braver Stallpintsch sein, oder ein edler, sanfter Vorstehhund, Terrier, Spaniel, oder sonst einer der vielen reinen, künstlich gemischten oder zufälligen, bastardierten Rassen angehören, in diesem Punkt haben sie alle miteinander dasselbe, törichte Benehmen. Die Katze ist nicht aggressiv; sie geht leise und lautlos ihren Weg, dicht der Mauer ent-lang. Sie versteht sich auf alle Künste und Bravouren der Flucht, sie hat eine große Meisterschaft im Ent-wischen. Aber, zum Kampf gezwungen, setzt sie sich gegen die Brutalitäten des Stärkeren gefährlich zur Wehr. Und für ihre Jungen tritt sie dem Feind mit einer unerschrockenen Wut entgegen, die schon Todes-verachtung heißt.
Atavistisch ist dieser Haß zwischen Hund und Katze allerdings, doch nicht ursprünglich, nicht {87} unbedingt von der Natur gewollt, wenigstens nicht an-ders gewollt, als sonst zwischen den Kreaturen dieser Erde Haß und Verfolgung, leicht entzündbar besteht. Aber Katzenmütter säugen hilflose junge Hunde, und lieben sie, Hundemütter nähren blinde, kleine Kätz-chen an ihrer Brust. Ich kenne einen bissigen deutschen Schäferhund, der stundenlang mit Katzen spielt. Wer zuschaut, schreit erst vor Entsetzen laut auf, denn es sieht bedrohlich aus, wie der Schäferhund so eine Katze beim Kopf in seinen gewaltigen Rachen nimmt, um sie hin und her zu schwenken. Er tut ihr nichts;
er denkt gar nicht daran, seine furchtbaren Reißzähne zu gebrauchen. Die Katzen wissen das, überlassen sich verständnisvoll ihrem Kameraden und treiben dann selber Kurzweil mit ihm.
Der Zuschauer begreift end-lich und lacht, gerührt und erfreut, wie jeder lacht, der eine Szene des Friedens erblickt. Vor Jahren hatte ich einen Otternhund, ein prächtiges Tier und so scharf, wie nur die Otternhunde sein können. Als er ins Haus kam, bangte ich für das kleine, arme, rote Kätzchen, das ich damals hatte und sehr liebte. Aber sie vertrugen sich augenblicklich aufs beste. Sie fraßen aus derselben Schüssel und schliefen auf der-selben Matratze. Der Hund ging nicht früher zur Ruhe, ehe er die Schlafgenossin bei sich hatte. Er holte sie, trug das winzige Ding im Maul behutsam zum Lager und sie schmiegte sich dann schnurrend in seine wollige Flanke.
Es gibt einen Frieden, es gibt ein Verstehen bei den Geschöpfen dieser Welt. Und Asis Domet der Araber {88} erinnert mich an meinen guten, schönen Tasso, den Freund der kleinen, roten Katze.
Von Tel Josef fuhr ich nach Beth Alpha. Ein paar junge Mädchen kamen gelaufen, als ich ins Auto stieg, und verlangten, mitgenommen zu werden. Der Weg führte wieder am Abhang des Gilboah Gebirges hin, war grasüberwachsen und holprig; ein Weg für Reiter und Bauernfuhrwerk. Chaim Mandelbaum lenkt das Auto vorsichtig, kunstreich, mit einer Geschwindigkeit, die manchmal zu sechs Stundenkilometer 'ansteigt", manchmal wieder fast null ist. Wie immer, sitze ich neben ihm, wende mich jetzt aber nach rückwärts zu den beiden Mädchen und wir plaudern. Sie sind alle beide hübsch, sind voll Frische und Lustigkeit. Vor drei Jahren sind sie ins Land gekommen. Aus Brunn die eine, die andere aus Wien. Weg von den Eltern, weg von Schule und Universität. Haben hier erst ein-mal das harte Los der einwandernden Chaluzim durch-gemacht. Taglöhnerarbeit. Seit zwei Jahren leben sie in Ain Charoth.
Ob sie nicht Heimweh haben? Sie lachen fröhlich und erstaunt. Hier gibt es so viel zu schaffen, hier ist man dem Boden so hundertfach verknüpft, hier wird man so erfüllt und durchdrungen von der ge-meinsamen Aufgabe... hier ist Heimat. Sie sagen das in einfachen Worten, ohne Großtuerei, ohne Tü-tütü. Also, ob sie nicht Sehnsucht nach den Eltern haben, nach Geschwistern? Das hätte ich eigentlich mit Heimweh gemeint. Ach ja, gewiß,... ab und zu... Sie wünschen ihre Angehörigen einmal wiederzusehen.
{89} Am liebsten hier im Lande. Man kann nicht alles so haben, wie man will. Trennung muß sein.
Sie unterhalten mich mit dem harmlosen Klatsch der Siedlungen. Heute ist Feiertag. Nun sind sie unter-wegs auf Besuchstour. Eben waren sie in Tel Josef, um dort Gäste für den Abend zu laden. Es gibt ein Fest.
In Beth Alpha fahre ich, dank den beiden jungen Mädchen vergnüglich ein. Mädchen, Burschen kommen von allen Seiten gelaufen, rennen neben dem Auto her. Man winkt, ruft, lacht, und da wir aussteigen, bin ich von einem Schwärm fröhlicher Jugend um-geben, von einem Wirrsal rasch durcheinander-sprudelnder Begrüßungsgespräche.
Eine ziemlich neue Siedlung ist Beth Alpha. Hier sind Intelligenzler aus Österreich und Deutschböhmen. Hier sind ältere Siedler, die schon jahrelang in Palä-stina leben, die hebräisch sprechen und Neuankömm-linge, die erst hebräisch lernen. Zwei Gruppen, deren Vereinigung die Zeit bewirken wird.
Man hat hier noch wenig Wohnhäuser, kampiert noch vielfach in Zelten, doch in der einen Gemein-schaftsbaracke finde ich zwischen dem Eßsaal und der Kanzlei eine Bibliothek von zweitausend Bänden.
Ein Mann im Anstreicherkittel begrüßt mich. Er ist ein alter Bekannter von mir. Vor Jahren hat er mich einmal wegen irgend einer studentischen Veranstaltung besucht. Seither ist er Jurisdoktor geworden, hat dann die Juristerei aufgegeben, zog in das Land der Ver-heißung, war, wie so viele, zuerst Taglöhner, hat {90} Steine geklopft, am Straßenbau gearbeitet und ist nun hier Handwerker, Schlosser, Schmied, Tischler und Anstreicher.
Er geht mit mir umher und zeigt mir die Kolonie. Das Vieh, die Pferde, die Ställe und Speicher, das Ackergerät, und die Felder. Hier, in Beth Alpha, haben sie sich unten, am Wasserlauf, eine Gerberei errichtet, um die Decken der gefallenen Rinder, der verendeten Ziegen oder der geschlachteten Hammel zu Leder zu verarbeiten und machen sich dann die Schuhe selber.
Deutlich fühlt man an diesen jungen Menschen den leidenschaftlichen Drang eines Volkes, sich wieder der Erde zu gesellen, eines Volkes, das so viele Jahrhun-derte lang verdammt war, in Städten zu wohnen, nur das Hirn zu üben, nur Verstandesarbeit zu leisten. Der Geist dieses Volkes ist nach und nach zu Abstrak-tionen verdampft, sein Empfinden wie sein Denken wurde überspitzt. Doch in seiner ungebrochenen Vi-talität spürt dieses Volk das Abstrakte und Überspitzte des eigenen Wesens selbst und ersehnt die Rückkehr, die Heimkehr zur Einfachheit des Bodens, der heilig ist überall in der Welt und doppelt, zehnfach geheiligt hier im Lande der Väter. Das Ideal der Heimkehr in dieses Land hat die Juden den Weg zur Gesundung geführt. Ein Volk von Gebildeten sind sie, von Köpfen, in denen Unruhe fiebert. Vergötterung der eigenen Art wechselt mit giftigem Abscheu vor dem eigenen Blut. Nun aber liegt der Weg offen, den die Jugend stür-misch beschreitet. Alles wirft sie hinter sich, um diesen Weg zu gehen. Niedersteigen zum Boden, einfach {91} werden und unwissend. Nichts kennen als die Be-schaffenheit der Erde, auf der man sät, um zu ernten. Ein Volk mit den Händen arbeitender Men-schen werden, den Kopf einmal feiern lassen, damit auch die Seele zur Ruhe komme. Haben sie alle Dinge, die dem leiblichen Bedürfnis dienen, nur fertig ge-kauft, glüht jetzt der Wunsch, brennt nun der Wille in ihnen, die Schicht zu bilden, deren kein Volk ent-raten kann; die Menschen, die an Pflug und Egge geschlossen, an Wind und Wetter gebunden, mit der Arbeit ihres Leibes und dem Schweiße ihrer Glieder alles schaffen, was das Leben der Menschheit nährt.
Es ist ein ungeheures Vornehmen. Man kann es nur ins Werk setzen, wenn ein begeisternder Gedanke hilft, all die namenlose Mühsal zu bestehen. Man muß so entflammt sein, so still und stetig entflammt, daß man es für nichts achtet, sich still und stetig zu opfern. Denn hier wird das Opfer eines ganzen Daseins nicht in einer hocherglühten Stunde und nicht mit einer heroisch dramatischen Gebärde dargebracht. Lang-sam, abseits der beifallspendenden Welt, ruhmlos, müdegerackert, aufgerieben in Jahren und Jahren der Robot sinkt man hin. Und andere treten an den leer-gewordenen Platz. Das Höchste ist erreicht, wenn man sich am Schlüsse sagen kann, daß man der großen Aufgabe treu geblieben und ihr nicht desertiert ist. Alle gehen sie hier in Palästina umher mit denselben Mienen, die bedrückt sind von der schweren Verant-wortung und erleuchtet von Enthusiasmus. Um das eigene Schicksal kümmert sich niemand!
{92} Diese jüdischen Bauern in Palästina sind ihre eigenen Ahnherrn, sie beginnen, ohne gelernt zu haben, ohne daß es ihnen nach einem so langen Ghetto im Blute säße, Bauern zu sein. Die Kolonisten und Far-mer, die nach Amerika gingen oder gehen, fanden und finden ein Land in strotzender Üppigkeit; sie müssen Urwald roden oder fette Prärien in Äcker verwandeln. Die jüdischen Siedler in Palästina finden die Wüste oder verkarstete Berge, oder Sümpfe, die Miasmen atmen. Dennoch schaffen sie, junge, unerfahrene Neu-linge, wie sie sind, reiches, blühendes Gelände, ernten, züchten Vieh, bauen Tabak, pflanzen Eukalyptuswälder, Ölbäume, Orangen und Bananen und ihre Landwirtschaft ist überall von der arabischen auf den ersten Blick durch ihre Musterhaftigkeit zu unter-scheiden.
Die Merkwürdigkeit dieses Bauerntums, das aus Menschen besteht, die niemals Bauern waren und den-noch Bauern sind; diese Landwirtschaft, der die Vor-aussetzungen fehlen, die sonst überall der Boden und die Leute bieten, und die trotzdem gedeiht; diesen Zu-stand, der mitten im Kampf alle Segnungen des Friedens hat, diesen Mangel an materiellem Gewinn, der gleichwohl zum beglückenden Erfolg wird, kann nur derjenige verstehen, der die alles besiegende Ge-walt einer großen Idee schon erlebt hat.
Der Mann, der an der Zentralstelle in Jerusalem das Departement der Finanzen leitet, Herr van Vriesland, besitzt neben sachlicher Nüchternheit die Phantasie eines Dichters und die Seele eines Künstlers. In seinen {93} 'Palästinensischen Paradoxen", die er für das Jahr-buch der Studenten von Leyden verfaßt hat, schreibt er: 'Das Wunder ist hier eine regelmäßig wieder-kehrende Erscheinung." Und er schreibt, in Palästina gelte es: 'Erst beginnen, dann besinnen." Er schreibt ferner: 'Die Ponderabilien sind nicht wägbar und die Imponderabilien wiegen zu schwer." Fast alle Pro-bleme des Aufbauwerkes sind in diese drei Sätze ein-geschlossen, alle Hindernisse und Widerstände, alle Psychologie der Jugend, die sich darbringt, aber auch die ganze Zuversicht des Gelingens ist in ihnen.
Ein Teil dieser Jugend glaubt nicht mehr an Gott, aber an Palästina glauben sie alle, ob gottesfürchtig oder gottlos, für das sie Wohlstand und Behagen da-hingeben, für das sie ein Dasein voll harter Arbeit auf sich nehmen und für das sie, wenn es sein muß, in voller Gefaßtheit sterben. Ein junger Siedler in Benjamina spricht: 'Ich wünsche nichts mehr; ich bin am Ziel all meiner Wünsche."
Er ist achtundzwanzig-jährig, ist ein akademisch gebildeter Mensch, liest phi-losophische und landwirtschaftliche Werke. (Auf seinem Tisch liegt das neue Buch von Hainisch.) Frei-lich, ihm geht es besser als tausenden anderen Kolo-nisten. Er besitzt eigenen Boden, nicht viel, aber genug, um davon zu leben, hat zwei Kühe im Stall und ein Ackerpferd. Trotzdem, es klingt sonderbar: 'Ich bin am Ziel." Welcher junge Mann in Europa kann mit achtundzwanzig Jahren das gleiche von sich sagen? Ich bin am Ziel! Aber auch die anderen denken so, auch diejenigen, die nichts besitzen, auch diejenigen, {94} die Steine klopfen oder Pferde striegeln.
Auch der arme Bursche, der als blinder Passagier übers Meer kam. Er ging von der mitteldeutschen Stadt zu Fuß nach Bremerhaven, schlich sich dort auf ein Schiff, wurde noch vor der Ausreise entdeckt und ans Land gesetzt. Da ging er von Bremerhaven zu Fuß nach Triest. Dort gelang ihm, was ihm in Bremerhaven mißglückt war, und er kam bis vor Jaffa. Als er aber ins Meer springen wollte, um ans Ufer zu schwimmen, faßten sie ihn, erwischten ihn zum zweitenmal in Haifa bei dem gleichen Versuch, bis es ihm endlich in Beirut ge-lang, ans Land zu kommen. Dann blieb noch, unter tausend Gefahren, die scharf bewachte syrische Grenze zu überschreiten, und als auch dieses Wagestück end-lich zuwege gebracht, als der Junge in Palästina war, konnte auch er sagen: Ich bin am Ziel!
'Wir sind getrennt von Europa, getrennt von Amerika, vom ganzen Westen, aber auch von so vielen Juden des Westens... werden sie uns jemals ver-stehen?" sagt der Doktor zu mir. '... werden sie end-lich verstehen, daß Palästina nicht für alle Juden ist? Daß niemand es von ihnen verlangt, sie sollen hierher-kommen? Und werden sie endlich begreifen, daß es ihre Pflicht ist, all denen zu helfen, die hierherkommen wollen? Daß diese Hilfe das Band ist, welches alle Juden der Welt untereinander verknüpfen kann, diese Hilfe, der einzige Anspruch, das einzige Recht be-deutet, das sie erwerben, sich je auf Palästina zu be-rufen, wenn Palästina einmal das geworden ist, was es werden soll und wird?"
Wir sitzen während dieses {95} Gespräches vor einer Baracke und warten, daß man uns zu der Festlichkeit ruft, die aus Anlaß des Purim-Abends veranstaltet wird. Es ist dunkel geworden. Die kahlen Gilboahberge schauen hernieder und der Mond hebt sich drüben, von Galiläa her, zum klaren Himmel.
Der Doktor spricht weiter: 'Was für ein Wesen macht man doch überall in der Welt von der jüdischen Solidarität! Und sie existiert gar nicht, wenigstens nicht aktiv. Ich habe sie noch niemals aktiv erlebt.. . Sie vielleicht?" Ich schüttle verneinend den Kopf. 'Sehen Sie," fährt der Doktor fort, 'im Krieg ist eine große deutsche Firma der Unterschleife und des Wuchers überführt worden. Kein Deutscher hat sich als Deutscher getroffen gefühlt. Natürlich, und mit Recht!
Aber wann immer sie einen Juden bei einer Schlechtigkeit erwischen, sind sofort alle Juden als Juden bestürzt und empört darüber. Ebenso natürlich und ebenso mit Recht. Denn der schlechte Kerl wird uns zehnfach angekreidet, wird uns aufgepelzt und wir müssen alle für ihn büßen. Da haben Sie die jüdische Solidarität. Das ist das Ganze ... mehr ist's nicht! Nehmen Sie uns, die wir hier in Palästina sind. Wir liegen im Dreck der Schützengräben, an der vordersten Front. Wir setzen Leib und Leben ein! Aber wenn uns das Hinterland im Stich läßt, wenn es nicht ausgiebig für Nachschub und Proviant sorgt, müssen wir krepieren!" Der Doktor macht eine kleine Pause und setzt dann hinzu: 'Ich fürchte, das Hinterland wird uns im Stich lassen. Wie ich die jüdische Solidarität kenne, das ist sie imstande."
{96} Wir werden gerufen, denn das Fest beginnt. Die Baracke ist voll Menschen, und bei dem Schein einer großen Hängelampe führen Kinder das Spiel von Esther auf, vom König Ahasver, von Haman und Mardochai. Ganz kindlich, ganz kunstlos. Eliahu Rappaport, der als hebräischer Dichter Rang und Namen hat und hier Schuhmacher ist, hat das kleine Stück ver-faßt und leitet das Spiel, indem er immer, so oft es nötig wird, hervortritt und mit den Kindern ver-handelt. Was Privatgespräche dabei sind, was zum Stück gehört, kann ich nicht genau unterscheiden, denn alles geht hebräisch vor sich. Wie aber dann der Esel auf der Bühne erscheint, den Mardochai be-steigen und Haman am Zügel führen muß, schwillt die Heiterkeit hoch an, und während Rappaport ganz vorne am Souffleurkasten mit einer großen, langsam von oben nach unten geführten Armbewegung das Fallen des Vorhanges markiert, der nicht da ist, donnert der Bretterraum von Gelächter.
Nachher das Abendessen, das gar nicht bescheidener sein kann. Ein Ei, etwas Topfen, trockenes Brot und Kaffee. Junge Mädchen, abgearbeitet, aber munter, ganz ohne Putz, aber nett, teilen die Portionen aus, sitzen dabei und nehmen am Gespräch teil, das von Dostojewski zu Strindberg, von Rachmaninow zu Chopin, von Rodin zu Lionardo springt. Lieber Gott, von was eben Bauern am Feierabend zu sprechen pflegen.
Dann übernachte ich in einem Zelt und kann lange nicht einschlummern. Durch den Spalt sehe ich die {97} anderen Zelte, sehe die Geräte und Wagen, ein Stück-chen Wiese und die steil aufsteigenden, nahen Gilboah-berge, die jetzt vom Mond beglänzt sind.
Auf diesen Bergen hier schlug König Saul seine letzte Schlacht gegen die Philister; hier fiel Jonathan, hier stürzte sich der König in sein Schwert. Und die Philister verheerten das Land, bis David kam.
Ich denke an den Satz, den van Vriesland ge-schrieben hat: 'Wir gehen, leben und arbeiten in Palä-stina neben unseren Ahnen und unseren Enkel-kindern."
Draußen singen die jungen Leute. Hebräische Lieder.
{98}
X
So bin ich endlich in Jerusalem. Ich habe das Land gesehen, noch nicht das ganze Land, aber ein Stück-chen davon, und es ist ein erwachendes Land voll Ge-genwart und Zukunft. Das junge Leben sah ich, das sich hier aufbauen will, und vernahm den Pulsschlag einer noch ungeborenen neuen Zeit, wie man den Herz-schlag des ungeborenen Kindes im Mutterleib hört.
Nun kann ich hier sein, in Jerusalem. Denn ich brauche hier nicht umherzuschleichen gleich dem Erben eines ruinierten Geschlechts, das seinen Grund-besitz und seine Burgen verschleudert und verloren hat. Eines Tages kehrt er zurück und die Mauern, die mit so vielen Erinnerungen zu ihm sprechen, herbergen andere; die Erde, die ihm so vertraut sein müßte, ist ihm fremd geworden und er wandelt auf ihr bitteren Herzens als ein Fremdling.
Ich werde jetzt nicht so in Jerusalem umhergehen.
Auch der Sturm ist jetzt nicht mehr so heftig in mir, wie das erstemal in jener Morgenstunde, da ich aus dem üppigen Kairo hier ankam und auf dem Bahnhof die Inschrift las: Jerusalem. Das stand da, wie auf irgend einem kleinen Bahnhof Jüterbog steht, oder Kemmelbach.
{99} Aber es klang wie Posaunenton: Jerusalem!
Dann fuhr ich im Auto durch die Senkung des Hinnomtales, fuhr wieder aufwärts, und sah die Stadt im Sonnenlicht vor mir aufgetürmt, fuhr am Jaffator vorbei und das ging schnell, leuchtete auf, war ver-schwunden, wie eine Vision.
Bald nachher zog ich weg von Jerusalem. Im Auto, das Chaim Mandelbaum lenkte, hinaus ins offene Land. Die Wahrheit zu reden, ich floh. Die Stadt war mir zu verwirrend für den Anfang, sie schüchterte mich ein, sie war mir zu schwer, drang mit zu vielen, mit zu argen Disharmonien auf mich ein. Niemals im Leben hat mich eine Stadt so nervös gemacht. Ich lief einfach davon.
Jetzt aber komme ich von Fluren und Feldern, über Tal und Berg, von biblischen Stätten zur biblischen Stadt. Nicht mit der Eisenbahn komme ich, sondern auf der Straße, den Ölberg herunter, nach Jeruscholajim.
Mit einem sonderbaren Gefühl von Ergriffenheit und Unruhe von Andacht und Verzweiflung gehe ich hier umher. Ich empfinde Freude, gesteigert bis zum Jubel, und spüre zugleich einen Schmerz, als sei mir ein Schwert in die Brust gestoßen. Erhoben bin ich in manchen Momenten, wie in einem Glücksrausch, und in anderen Augenblicken, sinkt mit allen dunklen Schatten Schwermut auf mich nieder.
Eine kleine Entwicklungskurve meiner Jugend kommt mir wieder zu Sinn. Viele, viele Jahre habe ich ihrer nicht gedacht. Jetzt aber ist sie plötzlich {100} wieder da, ist in meiner Seele und in meinem Den-ken, eine ganz scharfe Linie, ins Blut geglüht, gleich einer alten Narbe, deren Strich wieder brennende Röte zeigt.
Ich bin kein Jude gewesen, da ich ein Knabe war. Als Jude geboren, bin ich erst später, erst als Jüng-ling mit aufgewachtem Denken und aufgerütteltem Gefühl Jude geworden. Mein Vater gehörte mit allen seinen Anschauungen und Meinungen der liberalen Ära an. Er war ein wunderbar begabter Mann, von hinreißender Leidenschaftlichkeit erfüllt. Sprühend von Einfällen, von Frohsinn, immerfort fähig, zehn neue Pläne aus seiner unerschöpflichen Phantasie zu ersinnen, so oft ihm ein hoffnungsreicher Plan zu nichts zerrann, gütig bis zur Schwäche gegen uns Kin-der und seine Frau, unsere Mutter, dann heftig bis zum rasenden Jähzorn, aber selbst in seinen Ausbrüchen so durchleuchtet von Seelengüte, daß ihm niemand zürnen konnte. Er wurde vom Unglück verfolgt, doch nie verließ ihn seine heitere Tapferkeit dem Dasein gegenüber.
Er glaubte inbrünstig an die Versöhnung der Men-schen, an das Aufhören der Gehässigkeit von Volk zu Volk, an das Aufgehen der Juden in die Gemeinschaft der Nationen. Er nannte konfessionelle Unterschiede lachend überlebten Unsinn, warf seine jüdische Er-ziehung, die ihm als Sohn eines Rabbiners zuteil ge-worden, warf sein jüdisches Bekenntnis mit dem ganzen Ungestüm seiner impulsiven Natur beiseite und weil er, der liberalen Epoche gemäß, der er {101} angehörte, in seiner Gesinnung ein Kosmopolit war, ergab er sich auch einem unbestimmten, durch keine religiöse Regel oder Tradition gebundenen Pantheismus. Er kümmerte sich wenig darum, ob wir Kinder in Reli-gion unterrichtet wurden oder nicht. Und meine Mutter, still, sanft und kindlich mädchenhaft bis in ihr spätes Alter, verfuhr natürlich ganz wie ihr Gatte. Wir Kleinen beteten wohl zum lieben Gott: 'Vater, laß die Augen Dein - über unserm Bette sein." Aber wir hätten nicht zu sagen gewußt, was für ein Gott das ist, ein Judengott, ein Christengott oder ein Gott der Moslims.
Das erste konfessionelle Gebet, das ich lernte war das Vaterunser und der Englische Gruß. 'Gegrüßet seist Du, Maria, Du bist voll der Gnaden." Jahrelang hab ich das andächtig gebetet. In der Volksschule zu Währing war ich damals das einzige Judenkind. Und ich durfte in der Klasse bleiben, wenn der Katechet hereinkam zur katholischen Religionsstunde. Meine Mutter hatte das mit dem Oberlehrer der Schule ver-einbart, vielleicht, damit ich mich auf den ungeheizten Gängen nicht erkälten solle. Ich wußte nichts von dieser Abmachung und blieb mit Selbstverständlichkeit in der Klasse. Auch die Schule war damals noch liberal und der Oberlehrer machte kein Wesen aus dieser un-wichtigen Angelegenheit.
Die biblische Geschichte und ihre Wunder, die der milde, katholische Geistliche erzählte, nahm ich mit der ganzen Begeisterung auf, die sie in jedem Kinder-herzen entzündet. Ich erhob mich natürlich mit allen {102} anderen kleinen Jungen, wenn der liebe, alte Katechet hereinkam. Wir riefen ihm unisono entgegen: 'Gelobt sei Jesus Christus!" Leise und feierlich entgegnete er: 'In Ewigkeit Amen" und nun begannen wir erst das Vaterunser zu beten, hierauf das Ave Maria. Dann fing der Unterricht an. Ich lernte mit heißem Eifer; ach, ich brauchte gar nicht lernen, denn alles stand ja herrlich lebendig vor mir.
Von den Heiligenbildern, die der Katechet den fleißigen Schülern zur Belohnung schenkte, wurden mir viele zuteil, sogar jenes präch-tige, das ich so lang ersehnt, um das ich so ergeben gedient hatte. Zwei goldene Flügeltüren im gotischen Bogen waren da, aus Pappe, und wenn man sie öffnete, sah man die heilige Dreifaltigkeit, in Farben, die mir so himmlich dünkten, wie die reichverzierte goldene Pforte. Des Sonntags ging ich in die Währinger Kirche, zum Hochamt, das der Katechet für die Volksschüler zelebrierte, und ich sang Schuberts Deutsche Messe mit. Als dann in der vierten Klasse die Knaben, die man für reif genug hielt, ausgewählt wurden, um zur Beichte und Kommunion zu gehen, rief der Katechet auch mich hervor. Aber der Herr Oberlehrer bekam einen roten Kopf, flüsterte dem Katecheten leise etwas ins Ohr, worauf mir der Kate-chet übers Haar strich und freundlich sagte: 'Nun . .. vielleicht ein andermal." Damit wurde ich in die Bank zurückgeschickt.
Zu dem ,,andermal" ist es nie gekommen. Der kleine Junge, der ich damals war, ahnte ich nicht, daß ich in jener Sekunde in mein Judentum zurückgeschickt {103} wurde. Eine Zeitlang blieb ich noch katholisch fromm. Doch im Gymnasium ist es mir rasch klar geworden, daß ich Jude bin. Die Loslösung vom Christenglauben ging langsam, doch ohne heftige Krisen vor sich. Mein Judentum wuchs mit mir, je mehr ich heran-wuchs, reifte in mir, je mehr ich selber reif wurde.
Dann aber, als Theodor Herzl auftrat und ich mich an ihm bestätigt fand, als mich seine Gestalt, seine Menschlichkeit, der Umgang mit ihm entflammte, als sein opferbereites, mutiges Bekennertum mir und jedem ehrlich Empfindenden die Pflicht vorschrieb, bei ihm zu stehen und Israel zu bekennen... wurde auch mein Vater fromm.
Er war alt geworden. Un-gebrochen im Schwung und Impetus seines Wesens, aber doch alt. Die Erinnerung an seine Kinderjahre regte sich in ihm, umspielte ihn mit ihren Bildern, die so lange verschollen waren, umsang ihn mit den Stimmen von einst, die er so lange nicht gehört hatte, und die nun hervortraten, hervorklangen. Erscheinungen des Alters. Daß sein Sohn im Judentum Daseinsinhalt, Größe und Mission erblickte, hat es dem Vater leichter gemacht, den schwankenden Gestalten, die ihm nahten, sich willig hinzugeben. Er fing an, den Sabbath zu halten, er betete und psalmodierte hebräisch. Und als er starb, waren die letzten Worte, die er vernehmlich sprach: 'Kadisch! Kadisch!"
Diese Dinge rühren sich nun in meinem Innern und spinnen weiter, von der Kindheit und dem Vater, zu den Vätern und Urvätern. Die Geschichte meines Volkes öffnet sich mir in rasch erleuchteten, {104} ungeheueren Perspektiven. Abgründe tun sich auf und hauchen mich mit ihrem Schauer an; Aspekte er-glänzen und überschütten mich mit ihrem blendenden Strahl.
Vergangenheit ist wieder um mich her, ist in mir, diese ersten Tage, da ich in Jerusalem umhergehe, auf Schritt und Tritt.
{105}
XI
Mit hohen Mauern umgürtet, liegt die alte Stadt da. Abgeschlossen, von der neuen Zeit.
Die neue Zeit aber hat sich rings um das alte Jeru-salem gelagert. Im Kidrontal, im Tale Josafath, im Hinnomtal steigt sie die Bodensenkung hinunter, er-klimmt die Höhen des Skopus, des Ölbergs, ersteigt den Dschebel Abu Tor. Sie legt Villenviertel an, er-richtet Bankhäuser, baut Garagen, pflanzt Gärten, läßt Klöster entstehen, Spitäler und Schulen. Alle Nationen der Erde sind rings um Jerusalem ver-sammelt, alle Bekenntnisse des Christentums, des Islams wie der Juden belagern die Stadt im Kreis. Sieht man das deutsche Hospital auf dem Ölberg gleich einem Kastell, das französische Pilgerhaus, dicht am Damaskustor, das einer Riesenfestung gleicht, das Russenhaus, das nahe dem höchsten Punkt, ganz an der Stadtmauer gelegen, jetzt einer desarmierten Kaserne ähnelt, dann hat man etwa die strategischen Punkte vor sich, welche Belagerer festzuhalten pflegen.
Doch Jerusalem, das ja die Hauptstadt Gottes auf Erden ist, die Haupt- und Residenzstadt des Gottes, den alle anbeten und anrufen, Juden, Christen und Mohammedaner, das alte Jerusalem thront eben in der {106} Mitte einer glanzvollen Versammlung von Botschaftern, die alle Völker und alle Konfessionen hierher gesendet haben an dieses unsichtbare Hoflager des Unsicht-baren. Da sind sie nun versammelt, im weiten Bogen rings um die Mauer alle die amtlichen Reprä-sentanten, in großen, streitbar aussehenden Palästen, alle die frommen Pilger, die andächtigen Seelen, die sich hier seßhaft machen, um ihr Gewerbe im Schatten des Heiligtums zu treiben. Eine große, königliche Ge-folgschaft, ein bunter vielgestalteter Troß, der Extrakt christlich-jüdisch-moslimitischer Menschheit.
Die mauernumgürtete Stadt, die auf ihrem Felsen ruht, übersehbar und in sich verschlossen wie ein Schrein oder wie ein Sarkophag, ist das alte Jerusalem des Sultans Abd el Malik, der den Felsendom errichtet hat, das Jerusalem Gottfrieds von Bouillon, der sich den Beschützer des Heiligen Grabes nannte, das Jeru-salem Salah ed Dins, der die Kreuzfahrer wieder ver-jagte. Begraben und verschüttet, zugedeckt und einge-kapselt in diesem alten Jerusalem schläft das älteste Jerusalem des Königs David und des Königs Salomo, das Jerusalem von Juda Makkabi, von Herodes und Pilatus. Zerstört und versunken, lebst es immer noch. Viele Meter tief in die Erde gestampft und erstickt, atmet es noch immer in tiefen, langen Zügen. Sein Herz schlägt ruhig, gleichmäßig und fest. Man ver-nimmt das Pochen dieses Herzens bei Tag, wenn man im Gewühl der Menge hintreibt und es wird zum lauten Dröhnen des Nachts, wenn man im Mondschein durch die engen, leeren, schattenfinsteren Straßen {107} wandelt. Man begreift mit einem Male, daß man es immer schon gehört hat, wo man auch gewesen sein mag in der Welt, in welcher Stadt der fünf Weltteile, auf welchem Ozean oder in fernster Wildnis, überall hat man es gehört, das schlagende Herz des uralten, des versunkenen und dennoch in jede Gegenwart wirkenden Jerusalem.
Was mich in Ägypten so tief erschüttert hat, vor den gewaltig zerstörten Trümmerresten der gewaltigen Stadt auf der Nilinsel Elefantine, in den gigantischen Tempelstätten von Karnak und Theben, im Heiligtum des Amon zu Edfu und vor den Kunstschätzen des Museums zu Kairo, was mich dort überall immer so tief bewegte, war das vollkommene Gestorbensein dieser großen wundersamen Kultur, das Abreißen jeglichen lebendigen Fortwirkens. Das Versunken- und Vergrabensein im Wüstensand und in der Wüste zweier Jahrtausende. Dieses totale Aufhören einer so hohen Lebensform, darin so viel edelstes Können, so viel zartestes Empfinden und solch eine sublimierte Weisheit sich ausgesprochen hat.
Aber als der Dornbusch flammte, vor dem Moses ins Knie sank, als das Herz in Moses erglühte, be-gann das Reich der Pharaonen langsam zu sterben. Das Feuer, das von dem Gedanken eines einzigen, un-sichtbaren Gottes ausging, hat diese Welt verzehrt, in der man zu Ra und Ptah, zu Isis und Osiris betete, in der es Falken und Stiere als Götter gab, den Ibis und die Kobra. Kein noch so edles Können vermochte sie davor zu schützen, nicht das zarteste Empfinden {108} konnte sie bewahren, noch war die sublimste Weis-heit weise genug, sie zu retten. Dieser hohen Lebens-form verdorrten die Zeugungsorgane, sich fortzu-pflanzen, sie war unfruchtbar geworden und kraftlos und sie ging unter, ohne irgendeine Nachfolge.
Jetzt begreife ich diesen absoluten Untergang, verstehe ihn, tief erschüttert, im selben Augenblick, da ich fühle, wie sehr das in der Erde verschwundene, das unsicht-bare Jerusalem noch lebendig ist und welch ein lebensvolles Fortwirken ihm noch immer entquillt.
Und ich weiß hier auch, daß diese heutige Welt mit allen ihren Werken sterben und verschwinden muß, wenn der Gottgedanke eines Tages stirbt, ohne von einem höheren, zeugungskräftigeren Gedanken abgelöst zu sein.
{109}
XII
In dem großen, langgestreckten Haus, das die Kontorräume der Jewish Palestine Executive herbergt, ist der Pegel, der den Stand der Bewegung mißt. Der Seismograph, der jedes Schwanken verzeichnet, das Barometer, davon man Wind und Wetter von Morgen im voraus abliest. Hier ist die Bauhütte des ganzen Aufbauwerkes, hier sitzen seine Poliere und Werk-meister und Architekten. Der Bauherr zu London kann Direktiven geben und Instruktionen, aber hier arbeiten sie im lebendigen Material von Menschen und Erdboden.
Beständig ist dieses große, kahle Haus, mit seinen langen, geraden Gängen und in seinen vielen Kammern durchsummt wie ein großer Bienenstock. Man sieht Figuren hier, die aus Czernowitz oder Jassy zu kommen scheinen, Bursche, die in Whitechapel zu London oder im New Yorker Judenviertel aufge-wachsen sind, Jünglinge, deren vormals eleganten An-zügen es noch immer anzumerken bleibt, daß sie auf den Korsostraßen von Budapest, von Berlin oder Wien spazieren getragen wurden. Auch ältere Männer trifft man, doch nur wenige. Zermürbte Arbeiter aber selten. Dazwischen flitzen die Beamten und Beamtinnen, alle {110} sehr nett in ihrem Auftreten und in ihrem Äußeren, wie nur sonst irgendwo in Europa; alle freundlich in ihren Manieren, aber kurz angebunden; höflich, doch bestimmt.
Diese Leute reden einem nichts vor. Sie arbeiten. Sie treiben in ihren Gesprächen mit dem Besucher keine Propaganda; sie arbeiten und kennen nur ihre Arbeit. Sie reden nur von den Schwierigkeiten, er-örtern die Hindernisse, erwähnen die Aufgaben, die Probleme, die zu lösen sind. Immer die nächst-liegenden, immer nur die von heute und morgen. Und sie sind dabei sachlich, beinahe trocken.
Colonel Kish würde nach seiner Erscheinung, nach seinen brillanten Umgangsformen, seinem großen und gelenkigen Wissen und seinem liebenswürdigen Wesen jedem Ministerium oder jeder Ambassade zur Zierde gereichen. Der Sproß einer Familie, die mehr als hundert Jahre in Indien ansässig ist, kam er in Indien zur Welt, wurde Soldat und hat es im Krieg bis zum Colonel gebracht. Hier führt er die politischen Ange-legenheiten, namentlich die Politik mit den Arabern, und es kann schwerlich einen besseren Mann auf diesem wichtigen Posten geben als ihn.
Zu den vielen Sprachen, die er beherrscht - er meistert außer dem Englischen, das seine Muttersprache ist, außer Fran-zösisch und Deutsch noch etwa fünfzehn Idiome der indischen Völker und das Persische - hat er jetzt noch Hebräisch gelernt und Arabisch. Alle Fort-schritte, die in der Verständigung mit den Arabern er-zielt werden, sind zum größten Teil das Werk des {111} Colonel Kish. Dabei ist jeder Fortschritt, auch der geringste, schon als eine Leistung zu werten.
Denn die Widerstände sind enorm. Es gibt Hetzereien, die religiöse Ursachen haben und an denen sich die Christen vieler Länder, auch Englands, beteiligen, neben den religiösen Fanatismen der Mohammedaner. Es gibt politische Verhetzungen, die von Syrien auch nach Transjordanien geleitet und von da nach Palä-stina getragen werden. Und es gibt Hitzköpfe unter den Juden, die sich zur Gewaltmethode Jabotinskys bekennen. Zwischen all diesen heterogenen Elementen laviert und balanciert Colonel Kish geschickt und ehrlich. Sein sanftes, zärtliches Wesen, das wie Seide schimmert, macht ihn dazu besonders tauglich, sein stilles, heiteres Gleichmaß schafft ihm überall sofort Zuneigung, und die stählerne Energie, die an ihm dennoch durchzufühlen ist, die entschlossene Tapfer-keit, die sich in ihm birgt, sichern ihm zugleich über-all die nötige Achtung. Er selbst spricht niemals über seine politischen Aktionen, aber man hört davon im ganzen Land, bei den Juden wie bei den Arabern. Man redet gerne mit ihm von schönen alten Büchern, von Kunstwerken, Antiquitäten, orientalischen Teppichen, Bronzen und Stickereien. Denn er ist ein Kenner und Sammler.
Van Vriesland, der das Ressort der Finanzen leitet, gehört zu den erfrischendsten und erfreulichsten Menschen, die ich kenne. Dieser Mann, der sich mit den trockensten Zahlen und mit allen prosaischen Widerwärtigkeiten des Geldes herumzuschlagen hat, {112} besitzt eine träumerische Phantasie, verschlingt die moderne Literatur Frankreichs, Deutschlands und Englands, ist selbst ein Schöngeist und zu alledem ein unermüdlicher Arbeiter. Er hat die 'Palästinensischen Paradoxa" geschrieben, die ich in diesem Buche manchmal zitiere. Er schrieb sie, auf seiner Seereise von Amsterdam nach Jaffa, für einen Almanach der Studenten von Leyden. Er schreibt immer noch welche, denn in seiner großen Praxis fallen ihm täglich neue ein. Dieser Aufbau, bei dem man, nach seinen Worten, mit dem Dach beginnt, um später das Funda-ment zu legen, scheint ihm gelegentlich auf dem Kopf zu stehen. Aber er hat den fröhlichsten Willen, zwischendurch auch einmal kopfstehend zu arbeiten und er ist begeistert davon. Seine offene, recht-schaffene Art, heiter und laut, verbreitet Zuversicht.
In der Exekutive vertritt Professor Pick die Inter-essen der Misrachi, das ist, der strenggläubigen Juden. Keine leichte Stellung in einem Land, darin es indolente Juden gibt und Orthodoxe, Reformjuden und Atheisten und noch vielerlei andere Schat-tierungen, und in welchem es dennoch um die jüdische Sache geht. Als ich im Haus der Exekutive sein Zimmer betrat, waren eben einige Yemeniten bei ihm, Arbeiter, die Professor Pick nach Aden sandte, um von dort eine Gruppe anderer Yemeniten nach Palä-stina zu holen.
Auch hier sprach mich wieder der selbstverständ-lich demokratische Ton wohltuend an. Diese Leute aus dem Yemen sind unberührt von europäischer {113} Bildung, sind von der Kultur des Westens nicht zurecht-geschliffen, von der Forderung sozialer Gerechtigkeit nicht aufgeklärt. Doch sie haben Takt, sie haben Feingefühl und eine natürliche Menschenwürde. Sie kommen jedem brüderlich entgegen und Professor Pick verkehrt wie ein älterer Bruder mit ihnen. Er ist Assyriologe, der Professor Pick, und er ist es aus den einzigen drei Gründen, aus denen man Assyriologe sein kann, aus Neigung, Beruf und Leidenschaft. Aber seine Sehnsucht, im heiligen Land zu leben, war stärker, sein Antrieb, der jüdischen Sache zu dienen, war mächtiger; so hat er Berlin verlassen, hat einen Ruf an die Berliner Universität abgelehnt und ist nach Jerusalem gezogen. Manchmal, wenn ihm die Arbeit, der er sich hier widmet, Zeit dazu gönnt, nimmt er die großen assyrischen Faksimilebände wieder hervor und liest die Keilschrifttafeln, zur Erholung, wie unsereins, um sich zu zerstreuen, ein Unter-haltungsbuch liest.
Ussischkin, der den Bodenankauf leitet, ist das, was man einen eisernen Menschen nennt. Eine Vaternatur, aber ein Bärenvater, mit mächtigen Tatzen, die niemals wieder preisgeben, was sie einmal in ihren Fängen haben, sei es Besitz oder Meinung oder Gefühl. Treu bis zur Bereitschaft, sich für eine Sache oder einen Menschen ermorden zu lassen, ist er doch jeden Mo-ment zum Aufruhr bereit, wenn es nicht den Kurs geht, den er für den rechten hält. Er hat in der Uganda-Affäre die Opposition gegen Theodor Herzl geführt, den er doch verehrte. Er ist grimmig und gütig, naiv {113} und von außerordentlichem Intellekt, wird fast düster ernsthaft und steckt voll Humor; er hat ein vulka-nisches Temperament, zu feurigen Ausbrüchen geneigt und ist voll beherrschter Besonnenheit. Und er ist in diesem Lande die flammende Seele, ist der glühend beredsame Mund.
Viele Abende habe ich mit Colonel Kish verbracht, in seinem schönen, kultivierten Heim, das ganz ein Haus des Südens ist, mit kühlen Zimmern, mit kühlen, dunkeln Möbeln, mit bequemen Fauteuils, darin man kühl auf Strohgeflechten sitzt, mit prächtigen Tep-pichen auf den steinernen Fliesen des Bodens und mit Stickereien aus Bochara an den Wänden. Eines Abends saßen wir zu Tisch, um nach dem Essen in den Jewish Soldier Club zu fahren, wo ein Konzert statt-finden sollte. Der Gouverneur von Jerusalem war da und der Bürgermeister, beide mit ihren Frauen. Wir speisten rasch, denn wir mußten vor dem High Commissioner im Klub sein. Diesen Klub hat Colonel Kish gegründet, aus den gedienten Leuten, die im Krieg, viele von ihnen in einem der jüdischen Bataillone, ge-kämpft haben. Nun bietet sich in dieser Vereinigung ein Treffpunkt von Kameraden. Sie finden hier Gesellig-keit, finden hier eine Bücherei, veranstalten Musik-abende und tanzen mit ihren Frauen und Mädchen.
Wir kamen durch einen dunkeln Vorhof, der mit Lam-pions erleuchtet war, in ein kleines Haus, stiegen die Treppe hinauf in den ersten Stock und waren in einer Vorstadtwohnung, etwa in Hernais oder Meidling. Das Klubheim. Es ist, wie so vieles Neue hier, provisorisch.
{115} In den Zimmern ein Schwärm junger Menschen, Männer und Frauen, geputzt, festlich erregt. Ungefähr wie in irgend einem kleinbürgerlichen, jüdischen Ver-ein der Provinz oder der Vorstadt, sympathisch und anheimelnd. Eine Versammlung geistig interessierter Menschen, ohne Alkohol, ohne vieles Lärmen. Bald danach traf der High Commissioner ein, begleitet von einem Offizier, den die Adjutantenschnur schmückte. Colonel Kish, als der Präsident des Klubs begrüßte ihn mit einer Ansprache, die englisch anfing und hebräisch schloß. Dann begann das Konzert. Vorträge auf dem Klavier und auf der Violine. Der Pianist war vortreff-lich; ein wirklicher Künstler. Das junge Mädchen, das die Geige spielte, und der junge Mann, der Lieder sang, waren auf einem sehr anständigen Niveau.
Er sang Lieder von Brahms, von Schubert, von Mahler, die Texte ins Hebräische übersetzt. Zum Schluß des Konzertes stimmte der Pianist das 'God save the King" an und ließ ohne Pause die jüdische Hymne folgen. Sie wurde stehend angehört. Dann ging man zum Tee und wieder war mir der selbstverständlich freie Ton, das vollkommene Fehlen jeder Spur von Unterwürfigkeit, womit dem Bürgermeister, dem High Commissioner begegnet wurde, eine Freude. Als die offiziellen Persönlichkeiten sich entfernt hatten, wurde getanzt. Ich sprach mit einigen Herren, sah ihren Ver-kehr untereinander. Firmenchefs und Ladendiener, Polizisten und Künstler oder Professoren, es war kein Standesunterschied zu merken. Einige darunter, in Jerusalem geboren, waren nur nach Jaffa und Haifa {116} gekommen, andere wieder, gleichfalls zu Jerusalem gebürtig, hatten die ganze Welt gesehen. Wieder andere stammten aus England und waren erst vor etlichen Jahren nach Palästina eingewandert, vor dem Krieg, oder als Soldaten während des Krieges. Alle weckten den Eindruck, gescheit und tüchtig zu sein, fröhlich und sicher 'ein Leben zu machen", wie man in Jeru-salem sagt.
Einen anderen Abend bei Ussischkin zu Gast. Er haust im Oberstock einer Schule für Bodenkultur, in einer Wohnung, die herrliche Ausblicke von ihren Fenstern und Loggien bietet. Große Tischgesellschaft, einem Schuldirektor zu Ehren, der sein Leben in Jeru-salem gewirkt hat und nun siebzig Jahre alt geworden ist. Fast durchwegs interessante Menschen, Gelehrte und Politiker. Der High Commissioner und seine Frau, dann sein Sohn, ein netter junger Mann, der in Jeru-salem geheiratet hat. Ich sitze neben der Tochter Ussischkins, deren Mann als Direktor der agrar-zoologischen Versuchsstation in Tel Awiw wirkt. Ussischkin hält eine Rede, launig, temperamentvoll, mit ernstem Grundton. Er spricht hebräisch und fordert die junge Schwiegertochter Sir Herbert Samuels auf, seine Worte ins Englische zu übertragen. Wenn er einen Satz zu Ende gesprochen hat, wiederholt ihn die junge Frau sogleich. Das geht mit großer Exaktheit und erhöht merkwürdigerweise die Wirkung von Ussischkins Trinkspruch. Unmittelbar darauf antwortet der High Commissioner. Er spricht englisch und auch er verlangt {117} von seiner Schwiegertochter, daß sie Satz für Satz hebräisch wiederhole.
Einen unvergeßlichen Abend verbrachte ich bei Pro-fessor Pick, dessen ruhige Würde, getragen von leiden-schaftlichen, aber harmonisch ausgeglichenen Über-zeugungen, mir so sehr gefiel. Wir waren allein und konnten Zwiesprache pflegen. Er weiß, natürlich, wie viele Schwierigkeiten die Misrachi, die er vertritt, der Exekutive bereiten und es tut ihm leid. Aber er betont die Schwierigkeiten, die dagegen die Misrachi von manchen Organen der Exekutive zu erfahren haben. Beides ist unvermeidlich. 'Wenn ein Jude seine Lehre und seinen Gott verleugnet," sagt Professor Pick, 'was sucht er in Palästina?" Er lehnt für sich und seine Leute die Bezeichnung 'orthodox" ab. 'Wir sind glaubenstreu," sagt er, 'aber nicht starr und nicht ver-steinert. Wir wissen, daß die Religion in ihren Formen und Formeln elastische Eigenschaften zeigt und zeigen muß. Wir wissen auch, daß Anpassungen an geänderte Lebensweise und Denkart der Zeit vielfach notwendig sind. Aber gegen die vollständige Religionslosigkeit müssen wir ankämpfen."
Dieser Zwiespalt im Juden-tum scheint mir auf viele Jahre hinaus fast hoffnungs-los. Er kann durch Kompromisse, er kann durch Toleranz verdeckt, beschwichtigt, gemildert werden, zu überbrücken ist er kaum.
{118}
XIII
Es wird eifrig gebaut in dem neuen Jerusalem, das sich weit im Kreis um die Altstadt breitet. Stückweise, in Gebäudegruppen liegt dieses neue Jerusalem in den Schrunden der Täler, die von der Ringmauer nieder-stürzen, oder sitzt auf den Anhöhen der Hügel, die über die Altstadt hinausragen, oder klettert jenseits der Talsenkungen den Abhang des Ölbergs, des Skopus und der anderen Berge empör. Große Strecken freien Landes unterbrechen die Häuserreihen, die Quartiere, die sich Nationalitäten oder Religionsgenossenschaften errichtet haben.
In den Straßen sind viele Häuser durch die Ödigkeit großer Bauplätze voneinander getrennt. Überblickt man von einer der Höhen das Gelände oder schaut von einer Talsohle die Berghänge hinauf, so hat man den Eindruck, als seien viele kleine Städte konzentrisch im Anmarsch, um sich eines Tages zu vereinigen. Eines Tages, der noch fern ist. Jetzt kommt man noch durch Viertel, die ganz an die Armseligkeit elender Nester in Galizien erinnern, durch Quartiere, die reinlich, schmuck und ordentlich sind und den Eindruck kleinbürgerlicher Anständigkeit wecken. Da-zwischen immer wieder durch Ödland. Man fährt durch Villenstraßen, in denen, hinter hohen {119} Steinmauern mit prächtigen Torgittern, inmitten üppiger Gärten, reiche Araber oder Christen, oder hohe Be-amte prunkhafte Häuser bewohnen. Dazwischen immer wieder Ödland. Monumentalbauten stehen da, meist Spitäler oder Klöster oder Schulen, haben Groß-macht- und Großstadtallüren mit ihrer reichen Archi-tektur, wie das französische Pilgerhaus, das Haus der Deutschen, darin jetzt die englische Regierung sitzt. Aber dicht daneben wieder niedrige Hütten aus Lehm. Und dazwischen immer wieder Ödland.
Es gibt Straßen, in denen die Kaufladen mit ihren Schaufenstern, die Wechselstuben der Banken sogar schon einen gewissen Anstrich von Luxus haben. Doch nur ein paar Schritte durch eine kurze Seitengasse, und man ist wieder im Ödland. Die Häuser des nächsten Viertels stehen weit weg, jenseits der Wüste von Bauplätzen und Schuttablagerungsstätten, durch die nur schmale, ausgetretene, holprige Fußsteige führen. Einige große Boulevards werden angelegt, aber an ihren breiten, glattgewalzten Fahrdämmen stehen noch keine Häuser.
Später aber, wenn alle diese Gruppen und Viertel, diese Skizzen und Entwürfe, diese Anläufe und Vor-sätze sich zusammengefügt haben zu einer wirklichen großen Stadt, wird der Anblick reizvoll sein ebenso durch das Planlose, wie durch das Planmäßige, durch das Gegründete, wie durch das Gewordene, durch das Vielgestaltige, Abwechslungsreiche, aber auch durch das Internationale aller Bauten, Straßen, Plätze und Läden. Denn nirgendwo, in keiner Stadt der Erde {120} kommen die Menschen aller Völker und aller Nationen so buntgemischt zueinander, um nebeneinander zu wohnen, wie hier in Jerusalem. Diese Erscheinung, die dem christlichen, wie dem mohammedanischen Empfinden ähnlich verwurzelt ist wie dem jüdischen, muß der Politik des jüdischen Palästina-Aufbaues die Richtung geben.
Auf einem der vielen Hügel liegt, von Bäumen um-schattet, von Buschwerk umgeben das Haus der jüdi-schen Kunstschule 'Bezalel". Darin gibt es auch ein Museum, das all den Kram verwahrt, den der Direktor Boris Schatz im Laufe der Jahre auf seinen Reisen in Europa zusammengetragen hat. Er ist ein merk-würdiges Menschenexemplar, dieser feiste, alte Boris Schatz, der mit seinem langen Haar, seinem dichten Vollbart wie ein Pope aussieht, mit seinem Samtrock wieder an einen Photographen oder Zimmermaler er-innert. Auf seinem schon ergrauenden Haupt und auf seinen weichen runden Schultern ruht ein großes Verdienst und lastet eine schwere Schuld. Sein per-sönliches Verdienst bleibt es, diese Kunstschule ins Leben gerufen und in den ärgsten Nöten arger Zeiten erhalten zu haben. Darin ist er rastlos, ist unermüdlich und arbeitet seit vielen Jahren mit der Kraft eines Motors. Seine Schuld aber... lieber Himmel, er ahnt sie nicht; er weiß nicht das Geringste von ihr. Er ist in seinem Innern ganz naiv und er würde sie niemals begreifen.
In Bulgarien geboren, sieht er die europäische Kunst ganz mit den Augen eines Balkanmenschen an, und {121} er hat die junge jüdische Kunst in Palästina schon balkanisiert, noch ehe sie sich zu regen begann. Er fährt fort, die kaum erwachende zu balkanisieren. Sicherlich befinden sich in der Kunstschule des Boris Schatz Talente, sicherlich hat er auch den einen oder den anderen guten Lehrer. Aber da er selbst alles be-herrscht, alles durchdringt und auf alles abfärbt, kann die Anstalt zu keiner Entwicklung über ihren Direktor hinaus gelangen. In der Bezalelschule wird jede Technik geübt, von der Zeichnung bis zum Ölbild, vom Fresko zur Glasmalerei und zum Mosaik. In jedem Material wird gearbeitet, Holz und Elfenbein wird geschnitzt, Intarsien werden gemacht und Limogen, Ziselierungen, Gold- und Silberfiligran; Plastik in Bronze wie in Marmor. Aber alles ist aus zweiter und dritter Hand. Mit byzantinischen, arabi-schen und sezessionistischen Motiven, Einflüssen und Erinnerungen, denen sich noch die dekorativen Muster rumänischer Bauernstickerei und Teppich-weberei beigesellen, wird ein Stil gesucht, der palä-stinensisch sein soll. Er erreicht es aber nur, so ge-schmacklos zu sein, wie fast alle Arbeiten des Orients, die Europas Kunstformen nachahmen. Ein fast selbst-verständliches Resultat, denn diese orientalischen Ar-beiten wurzeln eben nicht in demselben geistigen Boden, dem die europäischen Kunstformen ent-wachsen sind. Solch eine vom Grund aus verfehlte Bemühung bringt es nur dazu, daß fast alles, was in Bezalel geleistet wird, unlebendig wirkt und entseelt.
In dem verstaubten Museum von Boris Schatz gibt es {122} eine Unmenge antiken und neuen Zierat, viel Wert-loses neben wenigen Gegenständen, die Wert haben und neben argen Stümpereien einige gute Bilder. Tieferen Eindruck hat mir nur ein einziger Raum ge-macht, an dessen Wänden der Zyklus 'Pogrom" von Abel Pann hängt. Diese farbigen Blätter, voll Kraft des Talents und voll Wucht des Erlebnisses, sind wie ein grauenhafter Schicksalschor. Man vergißt diese gemalten Szenen blutigen Leidens und namenloser Schrecken niemals wieder. Tieferen Eindruck übte mir auch das illustrierte Bibelwerk. Seine Vollbilder haben das Licht und das Kolorit der biblischen Landschaften. Die Gestalten vereinigen mit Natürlichkeit das Pathos der Legenden. Aber solche Künstler sind nicht von Bezalel erzogen worden, sie haben sich nur zu ihm gesellt, als nach der Balfour-Deklaration der Auf-schwung des Landes begann.
An Bezalel beweist sich, was sich im Brennspiegel der Kunst immer am deutlichsten zeigt: das Problem des erdgewachsenen Stiles muß durch eine andere Mischung von europäischen und orientalischen Elementen gelöst werden, als durch die dilettantische Kreuzung, die Boris Schatz versucht. Diese Lösung muß sich langsam ergeben, von selbst entstehend, aus dem Boden von Palästina und aus dem palästinensischen Erleben. Erst die nächste oder übernächste Generation wird fähig sein, eine autochthone Kunst zu gestalten.
Auf einer anderen Hügelstelle, umgeben von Bau-plätzen, steht das Haus der jüdischen Nationalbiblio-thek und ist von unten bis oben zum Platzen gefüllt {123} mit Büchern. Ein provisorisches Heim, wie manches andere jüdische Institut zu Jerusalem, wie vor allem die Exekutive, für deren Kontorräume man jetzt ein großes, neues Gebäude errichten wird. Vielleicht wird man auch der Nationalbibliothek ein Haus bauen. Das ist noch nicht entschieden, denn es ist möglich, daß sie auf den Skopusberg übersiedelt, wenn sie dort oben einmal die jüdische Universität vollendet haben. Jetzt waltet hier Dr. Bergmann, jung, sympathisch, bestimmt und von jener sanften Festigkeit im Wesen, die hier fast alle jüdischen Beamten auszeichnet. Er ist Direktor und richtet sich ein, so gut es eben geht. Die jüdische Nationalbibliothek enthält eine große und kostbare Sammlung Hebraica, aus vielerlei Erbschaft und Spenden. Sie hat die Hauptwerke aller Literaturen, sie ist auf dem Laufenden über die Neuerscheinungen in allen Sprachen und sie besitzt eine große Anzahl er-lesener Seltenheiten. Die Bibliothek von Popper-Lynkeus befindet sich hier, nach seinem letzten Willen.
Dr. Bergmann hat die Bücherei Poppers beisammen-gelassen und sie selbst nach ihrem Einlangen über-sichtlich aufgestellt.
Aus der ganzen Welt kommen Büchersendungen. Von überall her reichen diese geistigen Fäden bis zur Nationalbibliothek. Es ist verdienstlich, ihr Bücher zu schicken, gute Bücher, die der geistigen Schatzkammer Palästinas Bereicherung bieten. Was sie schon in vielen Exemplaren besitzt, gibt sie an Schulen ab oder an Vereinsbibliotheken oder sie verteilt diese Werke an {124} die Kolonien. Aber sie selbst braucht viele Bücher fünf- ja zehnfach.
Die jüdische Nationalbibliothek, die selbstverständ-lich allen Menschen, ohne Unterschied des Glaubens und der Rasse offensteht, wird viel in Anspruch ge-nommen. Immer ist ihr Leseraum voll von Menschen und an Zahllose leiht sie Bücher. Während wir in das Kabinett des Direktors gehen wollen, verweile ich vor einem großen Schrank kostbar gebundener Werke. Dr. Bergmann lächelt. 'Ein Geschenk der spanischen Regierung."
Eines Tages kam diese Wagenladung an, lauter Werke über Palästina und über spanische Ge-schichte. Dazu ein außerordentlich freundliches Schreiben der Regierung Spaniens. Sie widme diese Kollektion der jüdischen Nationalbibliothek, gerührt durch die Treue der spanischen Juden, die sich die spanische Sprache bewahrt haben, obwohl sie schon vor Jahrhunderten aus spanischen Landen vertrieben wurden. Ach ja, die Weltgeschichte liebt manchmal solch spanische Pointen.
Im Kabinett des Direktors sah ich, unter Glas, aller-hand Merkwürdigkeiten und Andenken. Dabei sind die Orden, die russischen und englischen, des Capitain Josef Trumpeldoor.
Auf dem Gipfel des Skopusberges, der vom Ölberg nur durch eine leichte Sattelsenkung geschieden ist, wird sich die jüdische Universität erheben. Ein Ge-bäude steht schon da. Es wird eben vollendet, während ich oben bin und muß jetzt wohl auch schon mit seiner Inneneinrichtung fertig sein. Das {125} physikalisch-chemische Institut. Auch die Universität wird allmählich wachsen. Ein paar Jahre noch und die medizinische Fakultät kann ihre Arbeit in vollem Umfang beginnen. Die anderen Fakultäten werden folgen. Das Haus, las hier schon am Fertigwerden ist, hat man mit dem Garten und mit umliegenden großen Grundstücken für die Universität erworben. Doch es mußte für seinen Zweck vom Grund aus umgebaut und durchgebaut werden. Es wimmelt und wirbelt innen und außen von Maurern und Handwerkern und diese Handwerker und Maurer, kalkbespritzt, weiß vom Staub der behauenen Steine, an ihren Kleidern mit Teer sind Farbe befleckt, wie sie sind, sehen trotzdem alle aus, als seien sie Universitätsstudenten. Viele von ihnen haben tatsäch-lich ein paar Semester auf europäischen Hochschulen verbracht. Aber es ist ihnen lieber, hier Taglöhnerdienste zu verrichten und sie singen.
Auf den Gerüsten singen sie und auf dem Dach. Sie singen, wenn sie durch den Garten gehen, um Steine oder Mörtelkübel herbeizutragen und singen im Trep-penhaus und in den künftigen Lehrsälen, deren Wände sie glätten. Vielleicht denken sie daran, daß sie später einmal wieder Studenten sein werden, hier an dieser Universität, an deren Bau sie jetzt arbeiten. Vielleicht haben sie auch dem Plan, selbst einmal ihre Studien zu vollenden, entsagt, und es ist ihnen nun eine Genug-tuung, daß hier eine Universität entsteht, ganz von jüdischer Hände Arbeit errichtet, eine Alma mater, die diesen Namen nicht bloß als einen sinnlos gewordenen Wortschmuck trägt, sondern wirklich eine gütige {126} Mutter sein wird, allen, die zu ihr kommen, um Wissen und Weisheit zu suchen, gleichviel, welcher Rasse sie auch entstammen, welchen Glauben sie auch bekennen mögen.
Ich treffe einen Herrn und es ist der Professor, dessen Institut hier als erstes seine Tätigkeit beginnen wird. Er führt mich durch alle Räume und wir gehen dann im Freien umher. Der Professor ist noch ein junger Mann, etwa vierzig. Er hat eine schlanke, ge-schmeidige, wie im Sport trainierte Gestalt, ein glatt-rasiertes Gesicht, wie gemeißelt, das in allen seinen Zügen von tätigem Geist erfüllt ist. Aus den Augen sprüht Intensität des Wollens. Auf deutschen Hoch-schulen ist er Professor gewesen und hat nur ein be-dauerndes Achselzucken, wenn man die vom Haß und Reaktion beherrschte Atmosphäre erwähnt, die den meisten dieser Hochschulen so charakteristisch ist.
Ein erledigtes Kapitel für ihn.
Ein Wiener Rektor hat sich den Ausspruch ge-leistet, es sei beklagenswert, daß wissenschaftliche Be-deutung einstweilen immer noch mehr Rücksicht finde, als Reinheit der arischen Rasse. Dieser Aus-spruch, an dem nur die Gesinnung wahr, die behaup-tete Rücksicht aber erlogen ist, malt einen ganzen Zu-stand. Habeat. Ein erledigtes Kapitel für den Pro-fessor hier oben auf dem Skopusberg. Über solche Dinge kann er nicht lächeln, denn er hat sie miterlebt, mag sie durchgelitten haben. Er runzelt die Stirne, die sich rasch wieder glättet. Weltenferne ist das alles von mir, endlos weit, sagt er. Und {127} unwahrscheinlich! Wir werden hier mit solchem Unfug nichts zu schaffen haben, meint er, und unsere Studenten werden gar nicht daran denken. Es liegt nicht in un-serer Art, und im übrigen sind Studenten fast immer das Echo und Abbild ihrer Lehrer. Die aber würden sich bei uns jede Unduldsamkeit, die sich zeigen sollte, mit aufrichtiger und härtester Strenge verbieten, würden jede im Keim ersticken. Es wird sich aber keine regen, noch zeigen.
Denn die Studenten würden ja nur die Niedrigkeiten legitimieren, unter denen die jüdische Jugend anderswo zu leiden hat, wenn sie hier nationalistische Torheiten anfangen und das höchste Palladium aller Universitäten antasten wollten, die Freiheit zu lernen und zu lehren - hier, in Jeru-salem!
Es weht eine frische Luft da oben auf dem Skopus-berg, kühl, klar und stärkend. Der Blick ruht auf dem romantisch-heroischen Bild der Stadt, die drüben, jenseits des Tales den Gipfel krönt. Weit über das grü-nende Gefilde und die funkelnde Stadt schweift der Blick dann hinaus ins Land. Da liegen die Berge von Judäa, jede Kuppe, jeder Fußbreit Boden bedeckt mit Geschichte und Legende. Gegen Osten engt sich die üppige Tiefe des Jordanbettes und blinkt der Spiegel des Toten Meeres, stahlblau unter dem saphirnen Himmel und der goldenen strahlenden Sonne. End-losigkeit atmet die Brust hier oben, atmet Vergangen-heit und ahnt Zukunft.
{128}
XIV
Viele von den Wohlgerüchen Arabiens, nicht alle, aber viele von seinen Wohlgerüchen durchströmen die engen Basargassen der alten Stadt und mengen sich mit den Dünsten der Arbeit und Dürftigkeit, mit den Miasmen des Elends.
Die Armseligkeit dieser Häuser, die hier so nah einander gegenüberstehen, wird manns-hoch und mehr als mannshoch von der grellen Bunt-heit der Basarläden überknallt. Das Alter dieser Mauern, die seit Jahrhunderten Menschen zur Woh-nung dienen, wird jugendlich verschminkt von der Farbenfrische der Waren, die da nebeneinander ge-stapelt sind, der Teppiche und Kochgeschirre aus blinkendem Messing, der bunten Stoffe aus Seide, Brokat, Linnen oder grober Wolle, die alle laut oder lauter schreien in ihren lichtgebornen Ornamenten; dann der klirrenden, klingelnden, mit Glasperlen oder falschen Korallen besetzten Riemzeuge, Sättel, Pack-taschen für Kamele, Esel und Maultier; dann der auf-gestapelten Lebensmittel, von den amerikanischen Konservenbüchsen bis zu den großblättrigen eben aus der Erde gegrabenen Gemüsen, von den Orangen-bergen bis zu den blutigen Fleischfetzen frischge-schlachteter und zerteilter Hammel, deren Hirn und {129} Lunge auf ihrem Fell gebreitet zur Schau liegen.
Dazu die Süßigkeiten in ungeheueren Mengen, Bonbons und Gelees und türkischer Honig und in großen Stücken, die feste Aprikosenmarmelade, wie Rinds-lederhäute über Kistendeckel oder Sessellehnen ge-breitet. Dies alles säumt als ein Harlekinmantel die steilen steinernen Ufer der labyrinthisch verschlungenen Rinnen dieser alten Stadt, darin die Menschen fluten von morgens bis abends. Vielgestaltig, farbig in Klei-dern, die noch Kostüme sind und die, wie in alten Zeiten, Beschäftigung, Bildungsgrad und soziale Stufe anzeigen. Uralte Derwische, junge Taglöhner, greise Schriftgelehrte, hübsche Frauen und Mädchen, gebieterische Araber, demütige Ghettojuden, mühselige arabische Mütter, den Säugling an der Brust und müh-selige jüdische Weiber, unendlichen Jammer in den Mienen, eilfertige Handelsmänner, immer mit der atemlosen Hast der letzten Minuten, Lastträger, rück-sichtslos raumgreifend, Müßiggänger in philosophi-scher Ruhe.
Und alles plaudert und ruft, lacht und schreit. Dazu noch das Klappern und Brüllen der Hausierer, die mit Limonade und Kuchen umher-ziehen. Das Tok-tok-tok der Esel, die klug, geduldig und behutsam in der Menge ihre Last oder ihren Reiter tragen. Das Schlapfen der Kamele, die gelassen, mit hochmütig wiegendem Kopf einherschreiten, un-willig und knurrend. Schleierschatten überbreiten die Turbulenz dieser schmalen Gassen. Manche von ihnen sind durch Plachen vor der Sonne geschützt. In {130} andere wieder fährt das Licht hinein als ein blenden-der Dolchstoß.
Oft habe ich die Altstadt durch das Jaffator be-treten. Das Jaffator mit seiner heroischen Silhouette, mit dem pathetischen Massiv der Davidsburg, mit seiner Wallfahrt zuströmenden Volkes, die es von allen Seiten beständig herbeizieht, mit der prächtigen Riviere von Stiefelputzern, die unter seinen Bögen hocken, jeder den geschmückten kleinen Kasten vor sich, dieses malerische, opernhaft umwimmelte und durchwirbelte Tor hat die Märchenstimmung aus Tausend und einer Nacht. Hier habe ich Volksauf-läufe gesehen und religiöse Prozessionen, christliche und mohammedanische. Hier sah ich einmal einen Hochzeitszug, eben von der Trauung kommend.
Still und schlendernd, wie in Gedanken, gingen alle Teilnehmer einher, andächtig, wie man Feiertags spazieren geht, achteten des geschäftigen Treibens nicht, durch das sie schritten, nicht der vielen Kinder, die sie um-drängten und umsprangen.
Die Braut trug ein weißes Atlaskleid, ihre Freundin-nen umringten sie, in einer Haltung und mit Mienen, als stünde ein schwerer Abschied oder eine schmerz-liche Prüfung bevor. Das junge Mädchen aber, hoch-erglühten Angesichts, schaute geradeaus, mit Augen, die niemanden sahen. Sie glich der Judenbraut von Rembrandt, die im Reichsmuseum zu Amsterdam hängt. Und ich kann diese Judenbraut vom Jaffator so wenig vergessen, wie die Rembrandtsche, die ich in Amsterdam gesehen habe. Sie ging auf dem Trottoir, {131} das von einer Steinbalustrade geschützt, den Stadt-graben der Davidsburg entlang in sanfter Kurve zum Tor abfällt. Sie war unberührt vom Leben in dieser Stunde. Doch sie war dem Leben, war ihrem Schicksal schon ausgeliefert und sie schritt ihm ahnungsvoll ent-gegen.
Die Davidsburg aber hob sich über dem Gewimmel winziger und flüchtig vergehender Menschenschicksale mit der pathetischen Wucht einer mittelalterlichen Feste. Kreuzfahrer haben diese mächtige Burg erbaut, die vom König David nur den Namen leiht. Sie bauten aus den Trümmern der Befestigung, die Herodes er-richtet hatte. Und Soliman, der Sultan errichtete wieder seine Zubauten aus den zum Teil zerstörten Trümmern des Werkes der anderen, eine Zeit auf dem Schutt dahingesunkener Vergangenheit. Der Turm dort ist, vielleicht, durch Herodes erstanden, hat den Namen Phasaël getragen, der andere hieß Hippikus-Turm. Vielleicht. Die Sprache von Jahrhunderten, die Akzente zweier Jahrtausende klingen hier oft so ganz ineinander, daß sie kaum zu unterscheiden sind.
Alle aber haben auf jüdischem Grund gebaut, hier in Jerusalem, in ganz Palästina, und, wenn man da umhergeht in dieser Stadt, scheint es einem, sie haben auch weit über die Grenzen des kleinen Landes hin-aus, in der ganzen Welt zum Teil auf dem Judentum, als auf dem Urgrund gebaut. In Jerusalem sind alle Untermauerungen, alle Fundamente jüdisch. Die steinernen und die seelischen. Das wird an den Steinen sichtbar, die hier lauter sprechen, zwingender, als {132} anderswo und weniger noch als wo anders gehört werden. Das wird am Seelenbau sichtbar, denn er ruht, ob er nun christlich oder mohammedanisch ist, immer auf der jüdischen Legende.
Die Moslims verehren in Moses den Vorläufer ihres Propheten und ziehen, alljährlich von Jerusalem aus, zu seinem Grab, darin er, der Entrückte, der Gott-begrabene, nach ihrer Überlieferung ruht. Sie haben ferner zu Hebron auf der Höhle Machpela, die den Staub unserer Erzväter birgt, eine Moschee errichtet, die als eine ihrer größten Heiligtümer gilt. Moses steht in Erz und Stein gebildet an christlichen Altären.
Die Psalmen des königlichen Dichters David werden zur christlichen Andacht gesungen. Seine Statue ragt an den Portalen der Dome und Münster. Noah, Samuel, Hiob, viele andere noch werden im Kult der moham-medanischen Religion wie der christlichen Konfes-sionen als ehrwürdige, von Heiligkeit umschimmerte Menschen betrachtet und abgebildet. Die Juden könnten sich über mangelnde Schätzung in der Welt nicht beklagen, wenn diese Welt eben nicht zweierlei Meinungen und so ganz entgegengesetzte, so sehr ein-ander widersprechende Meinungen hätte, von denen die eine, ewig unverrückbar den Gestalten der Ver-gangenheit gilt und die zweite, ebenso unverrückbar den lebendigen Menschen der Gegenwart.
Vielleicht müssen die Gegenwärtigen für die anbetende Ver-ehrung büßen, die ihren Urvätern gezollt wird. Mag sein, daß es eine andauernde Beunruhigung, daß es unerträglich ist, das Volk, das der Welt ihren Gott gab, {133} immer noch lebendig, immer noch erfüllt vom Geist seiner Bibel auf Erden wandeln und gegen jede Knecht-schaft wie einst in Ägypten revoltieren zu sehen, statt daß dieses Volk längst schon aufgesogen wäre vom Dämmergrund fernster Jahrtausende, aus dem es hervorgeschritten, längst schon versunken, wie die Pharaonen und unsichtbar geworden wie Jehova.
Wenn Moses, wie er in der Kirche San Pietro in Vinculi zu Rom, von Buonarotti geformt, dasitzt, als wolle er eben aufspringen und der leidenschaft-lichen Rede, die seine Lippen wölbt, freien Lauf lassen - wenn dieser Moses eines Tages sich erheben würde, und sein Mund zu donnern anfinge, dann müßten sich die Völker der Erde vor Scham verkriechen . . . und die Juden wahrscheinlich mit ihnen.
Vom Jaffator gehe ich des Morgens durch die enge gerade Straße, durch den buntgeschmückten langen Mauerspalt, durch die vom Jahrmarktstreiben er-brausende Rinne, die in die Altstadt führt. Die Sonne blitzt oben auf den Dächern der Häuser, der blaue Himmel zeigt hohe schmale Streifen, wenn man die Augen zu ihm aufschlägt. Die Luft ist dünn und kräftig, noch nicht schlapp geworden und nicht ver-dorben von den Dünsten des Tages. Und alle Gerüche sind nun frisch erwacht, sind noch nicht ineinander gemengt, sondern atmen, beinahe jeder für sich, ihre Milde, ihre Süßigkeit und ihre Schärfe. Kaum hundert Schritte habe ich getan und sah schon, wie überall in den Basaren des Orients, das Maß aller menschlichen Leiden und aller Qualen der Kreatur. Doch die {134} Geschäftigkeit des Lebens flutet und rauscht drüber weg und das Wellenspiel der Oberfläche kräuselt Frohsinn und Daseinslust. Die Rinne wendet sich, biegt um die Ecke, läuft dann wieder geradeaus weiter; sie senkt sich tief, Stufen kommen, unregelmäßig, und der ganze Menschenstrom stürzt wie ein Katarakt diese Senkung nieder. Man steht auf dem tiefsten Punkt des engen Pfades, der von da wieder aufwärts steigt, sieht den Katarakt von beiden Seiten niederrauschen, sich teilen, und nach beiden Seiten wieder buntgekleidete Menschen emporklimmen, rufend, plaudernd, brüllend, singend, dazwischen Kamele und Esel, die treppauf, treppab steigen.
In den Weg, den ich gehe, münden da und dort noch engere noch dunklere Pfade. Unverhüllt sind da die Häuser der bergenden Hülle von Kramböden entblößt. Ihre Armseligkeit ist nackt, grau und steinern. Nur ver-einzelte Gestalten gehen oder schwanken da herbei oder spielende Kinder schreien überlaut, oder ein Eselchen ruht, an die Mauer gelehnt, regungslos.
Ich gehe weiter, aufwärtssteigend, immer aufwärts. Hier ist das alte Jerusalem, errichtet auf dem Schutt und den Trümmern des uralten.
Dann durch einen Torbogen, dämmerig und hallend, vorbei an den arabischen Wächtern und ich bin in der Fülle der Sonne, in der Weite des Blicks; auf dem Tempelplatz.
Aus ihren Schluchten und Schlünden, dicht benistet und eng bewohnt, aus dem hundertfach verschlungenen Gedärm ihrer Gassen und Gäßchen, aus dem {135} dunkel sich drängenden irdischen Gewühl hob diese Stadt ihren Tempel dem Himmel entgegen.
Wer aus Jerusalem hier heraufkommt, steht über dem Werktag im Erhabenen, über der Finsternis im Licht, über der Enge in der Freiheit.
Das hat Salomo, der Dichter gemeint, als er hier auf dem Moriahberg die Residenz für Jahwe erbaute, und das ist heute noch die Wirkung.
Eine riesenhafte Opferschale ist dieser Platz, von hundertfünfzigtausend Quadratmetern, eine Opfer-schale, emporgehalten aus der Seelentiefe eines Volkes. Ein zum Denkmal gewordener Ausbruch leiden-schaftlicher Andacht. Ein Gleichnis dem Wesen aller Menschen, das mit seinen Trieben, mit seinen Wün-schen, Arbeiten und Schicksalen in den Niederungen nah beisammenklebt, und das in seiner Sehnsucht nach Ewigkeit, in seiner Anbetung des Göttlichen über sich selbst hinaussteigt zur Gipfelhöhe, wo das Auge ins Unermeßliche schaut.
Welch eine Szenerie! Groß und feierlich, monu-mental und anmutig.
Enorme Steinplatten, die den Boden pflastern, machen ihn flimmern und festlich blenden im Strahl der Sonne, die unaufhörlich niederscheint. Die Moschee, die hier steht, ein herrliches Oktogon, in leuchtenden Farben blauer Fayence, die das Himmels-blau festzuhalten scheinen, wirkt wie ein Schmuck-stück, wie feiertäglicher Tafelaufsatz auf einem Riesentisch. Diese Omar-Moschee, dann die Aksa-Moschee dahinter und die Kanzeln, die {136} Himmelfahrtskuppel des Propheten, alle diese Monumentalbauten nehmen sich zierlich aus, auf der monumentaleren Fläche des Platzes.
Unendlicher Rundblick. Steil fällt der Moriahberg zum Kidrontal hinunter, das sich in der Tiefe windet. Dort unten steckt das Türmchen des Absalom-Grabes seinen Zeigefinger in die Höhe, dort drüben, an den Rand eines der Gärten geschmiegt, die den Namen Gethsemane alle in Anspruch nehmen, das Grabmal der Maria. Jenseits des Kidrontales schwellen in mäch-tigen und lieblichen Hängen der Skopus, der Ölberg und der Berg des Verderbnisses.
Bibelstätten, wohin das Auge sich wendet. Altes Testament, Neues Testament, Islam, in einer mild heroischen Landschaft.
Und Bibelstätten hier oben, auf dem Tempelplatz. Altes Testament, Neues Testament, Islam. Die Omar-Moschee ist um den Felsen errichtet, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte, weil Gott es verlangt hatte. Dieser Felsen ist der älteste Stein der jüdischen Legende. Gleich der Rückenflosse eines vor-sintflutlichen Ungeheuers ragt er ein wenig aus der Marmorfassung, die ihn umgibt. Geborsten, zerschrundet und von klingend tiefem Braun, ähnelt er dem Leib einer Mumie. Das Geheimnis seines Schwei-gens, das Rätsel seiner Vergangenheit, das Mysterium all seiner Erlebnisse überdämmert ihn, und das matte, in spielenden Farben webende Zwielicht, das durch die bemalten Fenster dringt, aufgefangen von ver-goldeten Gittern, von marmornen Balustraden, von {137} Wänden, die mit farbigen Steinplatten und farbigen arabischen Inschriften bedeckt sind. Auf diesem Fels, der Abrahams Gehorsam sah, haben die Juden ge-opfert und gebetet, auf diesem Fels haben christliche Kreuzfahrer ihre Altäre gebaut und die Mohamme-daner verehren diesen Fels als ihr heiligstes Heilig-tum neben der Kaaba zu Mekka.
Die Erzählung von den drei Ringen - aus Lessings Weisheitsdichtung, aus dem 'Nathan", hier greift sie einem nur wunderbarer, mit versöhnender Kraft ans Herz. Auf diesem Boden, hier unter der Kuppel der Omar-Moschee, im Angesicht des Felsstückes, das den Juden, wie den Christen, den Christen, wie den Moslims für geheiligt gilt, fühlt man erschüttert die Ein-heit aller Menschen, die zu dem einen, unsichtbaren Gott beten.
Hier an dieser Stelle, wo der uralte Bibelboden in dem gespaltenen Fels seinen steinernen Mund zur Ge-genwart emporhält, wird man mit Augen gewahr, wie alles in Jerusalem, die Stadt und die Festung, die Wohnhäuser und die Kirchen, die Minaretts und die Moscheen auf dem Urgrund des Judentums erbaut sind.
'Der Herr siehet", sprach Abraham, da der Engel zu ihm rief, er solle Isaak losbinden. Und Moriah wurde der Berg genannt, 'da der Herr siehet". Er hat immer auf diesem Berg gewohnt, der unsichtbare, an-sehende Gott. Bloß die Diener seiner Wohnung haben gewechselt im Gang der Jahrtausende. Die Götzen, die {138} manchmal da zu Gast geladen wurden, schmolzen weg in seiner Nähe gleich Schneeflocken in der Mittag-sonne. Und die Götter Roms, die mit den Heerscharen des Titus Jerusalem zerstörten, glaubten den Juden-gott besiegt, glaubten, ihn mit all seiner exklusiven, hochmütigen Strenge vernichtet zu haben. Doch sie waren schon entkräftet, sie hielten die Gewalttat, die hier verübt wurde, für ein Zeichen von Gesundheits-fülle, von unbezwinglicher Macht und wußten nicht, daß es nur tobendes Umsichschlagen der Agonie war.
Die Juden aber erlebten wieder einmal ihre Schick-salsstunde, eine der schwersten, eine der am meisten von Folgen beladenen Schicksalsstunden. Sie standen an der schmalen Grenze zweier großer Zeitalter, und es blieb kein Raum für sie übrig. Sie hielten auf der Kante, die zwei Abgründe voneinander schied. In den einen Abgrund versank die alte Welt, dem anderen wollte sich die neue Welt entringen. Sie sahen nur, daß ihr Untergang gekommen sei und ahnten nicht, daß ihr Fortdauern sich jetzt erst erfüllen sollte. Ein-gekeilt zwischen den neuen Menschen, die ihnen ihren Gott fortnahmen, um ihn über die Erde hinzutragen und den in Waffen starrenden Beherrschern der bis-herigen Welt, die ihnen ihre Götzen brachten, um sie ihnen aufzuzwingen, klammerten sie sich mit dem ganzen Fanatismus, mit der ganzen Zähigkeit ihrer Treue an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen, und sie starben für Jehova nach beispiellos tapferer, beispiellos verzweifelter Gegenwehr, sie ließen, um Jehovas willen, seine Stadt und seinen Tempel {139} zertrümmern, und für ihren Gott zogen sie in die Fremde, in alle Bitternis der Verbannung.
Hier aber, auf Moriah, wo der Herr immer gewohnt hat und immer noch wohnt, versteht man den Sinn dieser Tragödie, die ihresgleichen nicht hat in der Ge-schichte der Menschheit. Damit die Juden als eine Ge-meinschaft weiterbestehen, mußten sie zerstreut werden. Damit ihr strenges, erhaben reines Ethos der imaginäre Boden sei, fruchtbar und wurzelkräftig, be-ständiges Leben, beständige Erneuerung spendend, mußten sie den Boden ihres Landes verlassen, durften keine Heiligtümer der Vergangenheit, keine Stätte der Erinnerung an Väterzeiten hegen, als in ihrer eigenen Brust.
Ganz Gehirn und ganz Seele mußte dieses Volk werden, um nicht zu verschwinden mit all den anderen Völkern, die verschwunden sind. Denn die Erden-sendung der Juden war noch nicht vollendet. Und sie mußten untergehen, um erhalten zu bleiben.
{140}
XV
In den engen Straßen der alten Stadt findet man Angehörige aller Völker, die das Entstehen der neuen Religionen miterlebt und miterkämpft haben. Von jedem dieser Völker sind beständig Sendboten hier in Jerusalem. Pilger, Bettler, Unternehmer, Agenten, Touristen, Priester, Menschen, die ihr Leben verfehlt haben und nun ihre Tage in einer dumpfen, ver-zweifelten Andacht hinschleppen.
Hier, auf den schmalen Steinwegen, die zwischen ur-alten Häusern bergauf bergab führen, im Gewühl der Basare, begegnet man ihnen, wird von ihnen ange-sprochen, fast hätte ich gesagt, angefallen, demütig oder dreist, schüchtern oder frech, immer jedoch mit einem Unterton vertraulicher Brüderlichkeit. Es ist unmöglich, sich ihrer anders, als mit Sanftmut zu er-wehren. Wenigstens habe ich es niemals zustandege-bracht, unwirsch zu sein. Hier in Jerusalem nicht. Wir sind alle Kinder Gottes und Gott wohnt hier in Jerusalem. Deshalb sind die Menschen hier brüderlich zueinander; wenn sie sich nicht gerade totschlagen. Aber heute ist kein hörbarer Zwist, keine sichtbare Eifersucht, sondern Friede auf allen Wegen. Und ich {141} merke, daß auch ich unwillkürlich in den Bruderton falle, wenn ich mit jemandem hier spreche.
Es ist ein heller Frühlingsmorgen, so grell und hell, daß selbst diese dämmernden Mauerrinnen, auf deren harten Boden man geht, lichtvoll erscheinen. Manch-mal liegt ein Fleck von Sonne auf einer Hauswand, über einer Menschengruppe. Dann blickt man auf und sieht den schmalen Streifen eines dunkelblauen Himmels über sich, der vom Sonnenschein golden durchfunkt ist. Aber die Luft bleibt frisch und kühl.
Ich gehe allein und weiß wohl, wohin ich will, aber ganz und gar nicht, wohin ich komme. Undenkbar, sich die ersten Male in diesem Labyrinth von Gassen zurechtzufinden. Sie sind, hier in der alten, von Festungsmauern umschlossenen Stadt, so schmal, daß kein Wagen fahren kann. Und Esel wie Kamele win-den sich hier durch die Menge der Menschen, steigen geduldig und sicher die Straßenstufen auf und nieder. Das moderne Jerusalem mit seinen Reitern, Pferde-wagen und Automobilen braust draußen, rings um die Basteien.
Unversehens bin ich wieder auf dem Tempelplatz.
Von dort gehe ich zum Haus des Pilatus. Das steht in seiner ruinenhaften Verlassenheit am Rande des Platzes, und eine Pforte entläßt mich in eine enge, öde Steingasse.
Der Weg, den Jesus nach Golgatha ging. Die Via Dolorosa.
Nun folge ich diesem Weg und bin ganz in der christlichen Vorstellungssphäre. Hier der Bogen ist die {142} Stelle, an der Pontius Pilatus sein ecce homo! sprach. Dort die Station, da Jesus zum ersten Male hinsank und weiter, auf diesem öden, gewundenen Weg Leidenstation an Leidenstation. Ihre Denkzeichen sind in den Stein der Häuser gehauen, obwohl der eigentliche Weg viele Meter unter der Erde verdeckt vom Schutt so vieler Jahrhunderte liegt. Man hat in dieser alten Stadt, in der ein Haus das andere stützt, fast niemals Ausgrabungen gewagt. Wie viel heiliger Boden ans Tageslicht käme, merkt man an den Aus-grabungen, die von den Augustinern dicht vor der Festungsmauer verrichtet werden und an Erdarbeiten, die am Grabmal Absaloms geschehen. Doch ist es der-selbe Weg, den Christus zur Richtstätte schritt, das schwere Kreuz auf den schmächtigen Schultern. Der Weg, den er wankte, taumelte, niedersank, sich wieder aufraffte und sich weiterschleppte.
Er ist mir eine unbezweifelbare Wirklichkeit, dieser Leidensgang.
Um historische Forschungen, um beweisgestütztes Vermuten, um Widersprüche und all das Zeug kümmere ich mich nicht.
Was ist Wahrheit? hat schon Pilatus gesagt. Wen das Vergessen Ereignisse auslöschen kann, als seien sie niemals geschehen, so hat der Glaube zweier Jahrtausende die Schöpferkraft, nie geschehenen Be-gebenheiten volle lebendige Wirklichkeit zu verleihen.
Jesus ist wirklich gekreuzigt worden. Nur der Weg nach Golgatha ist von der exakten Wissenschaft noch nicht erforscht.
{143} Meinem Herzen und meinem Denken bleibt das gleichgültig. Ich glaube an die Schöpferkraft des Glaubens.
Hier ist der Weg, diese enge Straße da, durch die ich gehe! Der Glaube bezeichnet sie als den Weg und gegen diese, von vielen Jahrhunderten geschaffene Realität verwirft die Phantasie jeden Appell.
Hier ging der kleine, traurige Zug, der den jungen, edlen Rabbi zum Tode führte. Das Schreiten römischer Soldaten, das laute Klagen und Weinen seiner An-hänger ließ in diesen schmalen, vom Alltagsgetriebe erfüllten Gassen ein schwaches Kielwasser von Auf-sehen zurück, das bald wieder verschwand. Die Last-träger, die Straßenhändler, die unbeteiligte Menge schloß sich rasch wieder; schwatzend, lärmend, rufend, von bepackten Eseln durchtrabt, von hoch-beladenen Kamelen murrend durchschritten.
Die Sonne schien vom blauen Himmel wie heute, blendend und stumpf; ihr gelbes Licht knallte an den gelben, kahlen Steinwänden.
Dann aber stehe ich auf dem Platz vor der Grabes-kirche.
Golgatha und Kalvarienberg.
Steinerne Fronten, schmucklos, streng. Sonnenlicht blinkt auf den Quadern, blendet am Boden. Durch die schwarzdunkle Öffnung des Tores nachtet der Schatten des Kircheninnern.
Da gleitet eine Schwalbe aus der Luft nieder. Hilf-los schlägt sie auf den Stein, zuckt mit den Flügeln, hebt den kleinen Kopf, ringt in letzter Not.
{144} Ehe ich noch meiner Bestürzung Herr werde, springt ein Mann von der Mauer, an die er gelehnt saß, herzu, packt die sterbende Schwalbe und schleudert sie in die Höhe. Klatschend fällt sie wieder aufs Pflaster und eine Katze, die eilends herbeihuscht, schnappt sie ins Maul. Noch einmal schlagen die schönen Schwingen, heftig und ziellos. Es ist wie ein stummes Schmerzensschreien. Dann beißt die Katze zu, man hört ganz leise, aber ganz deutlich das kurze, letzte Knirschen der zarten, splitternden Knochen. Und nun schleicht sie mit ihrer Beute fort, gefolgt vom Ge-lächter jenes Mannes.
Ich gehe rasch davon, beschämt, mißgestimmt, ver-zweifelt.
Erst am ändern Tag wandle ich wieder denselben Weg und gelange wieder hierher.
Das Sterben der kleinen Schwalbe durchzuckt meinen Sinn, während ich den Kirchenplatz betrete. Aber hier ist keine Spur mehr davon zu sehen, sowie es keine Spuren von all den Menschen gibt, die auf diesem Platz gelitten, geblutet haben und gestorben sind. Doch ich meide die Stelle, an der die kleine Schwalbe gestern niederfiel, um den Tod zu erleiden. Und Rührung im Herzen betrete ich die Kirche des Heiligen Grabes.
Mein Empfinden fragt nicht danach, ob die Stelle auch authentisch als diejenige bezeichnet werden kann, an der Jesus gekreuzigt und begraben wurde. Man sagt jetzt, dieser Platz da sei noch innerhalb der alten Mauer des Herodianischen Jerusalems gelegen, und im {145} inneren Bereich der Stadt sei niemals ein Mensch hin-gerichtet oder beerdigt worden. Das mag richtig sein.
Die Forscher, die das herausgefunden haben, christ-liche Gelehrte, werden nur noch die alte Stadtmauer wieder bloßlegen und der Beweis für ihre Behauptung ist erbracht. Trotzdem! Der Glaube von tausend Jahren wird auch diesmal stärker sein, als das Geschehen einer Stunde. Dieser Glaube schafft Tatsachen, die mehr Kraft haben, als eine ins Vergangene hinab-gesunkene Wirklichkeit. Er hat die schöpferische Ge-walt der Poesie, dieser Glaube, dem sich Millionen Menschen jahrhundertelang hingeben. Und wie der spanische Infant Don Carlos, wie der Schweizer Wilhelm Teil, wie der österreichische Wallenstein in der Tragödie lebendiger sind als in der historischen Wahrheit, ja wie ihre vom Dichter geformten Gestalten das Wesen der einst wirklichen Originale im Bewußt-sein der Menschen vollständig verdrängt haben, so hat der Glaube den Platz, an welchem er die Doppelkirche erbaute, unwiderruflich als Golgatha und Grabstätte bestimmt. Hier in der Nähe, hier, im engen Bereich dieses Stadtgebietes, muß ja das Ereignis der Kreuzi-gung ohnehin vor sich gegangen sein. Es ändert sich also im Grunde nur wenig, mögen auch die wirkliche und die imaginäre Stelle um ein paar Klafter ausein-ander liegen.
Aber meine Bereitschaft, im Doppelraum dieser Kirchen tiefere Eindrücke zu empfangen, bleibt ver-geblich. Die bizarre Konstruktion des Raumes, das Ineinandergeschobensein der beiden Kirchen {146} interessiert allerdings, aber es verwirrt auch zugleich. Das Herandrängen der verschiedenen christlichen Kon-fessionen in herausforderndem Wetteifer, die Starr-heit, mit der jede an der ihr zugewiesenen, zu-geschnittenen Stelle nicht ohne Feindseligkeit gegen die andere verweilt, hat etwas Trübseliges, Rührendes und Trostloses. Daß die Priester an hohen Feiertagen, statt ihre Andacht gemeinsam zu erheben, sich ge-prügelt haben, gerade hier, vernimmt man mit Ent-setzen und Ergriffenheit. Die aufgehäuften Opfergaben, Votivgeschenke und Devotionalien geben keine Stimmung. Das dichte Dschungel von silbernen und vergoldeten Ampeln, wovon das Gewölbe behängt ist, wirkt in der Fülle einer immer sich wiederholenden Form wie Gedankenarmut.
Die Kostbarkeit von Mar-mor, Onyx und anderem Gestein, die Reichtümer, die da gehäuft sind an Gold und Juwelen, geben gerade an dieser Stätte das Gefühl armseliger, fast bar-barischer Schaustellung von wertlosen und neben-sächlichen Dingen. Monarchen und fromme Für-stinnen haben sich durch ihre Erdenmacht und ihren Besitz gerade hierher gedrängt, wo irdische Macht und irdisches Gut zu Nichts zerrinnen soll. Und kein Kunstwerk adelt den angesammelten Mammon, daß er des Adels dieser Stätte würdig sei. Kein Meister-werk hilft dem Gemüt hier zu Aufschwung und Er-fülltsein.
Die Wallfahrtskirche in Mariazell ist mit ihrer strahlenden Barockherrlichkeit großartiger und wirkungsvoller.
{147}
XVI
Zwischen raufende Männer auf einer Straße in Jerusalem springt der Polizeischutzmann, um die Kämpfenden zu trennen. Er braucht weder Körper-kraft noch Drohung. Mit lauter Stimme zitiert er den Psalm, in dem es heißt, nicht mit Gewalt werde ein Meinungsstreit entschieden. Und es ist weder salbungs-voller Ton noch fromm tuende Milde in seiner Stimme, sondern ein heftiges 'Wißt Ihr denn nicht?", ein zornig erstaunter Vorwurf, der zu sagen scheint: 'Ihr Törichten, wie habt Ihr dieser Wahrheit vergessen?" Er hält ihnen den Psalm unter die Nase, wie Schutz-männer anderswo auf Polizeiverbote oder auf ange-drohte Strafen hinweisen. Er benützt den Psalm als ein Argument, das schlagend lebendig und allgemein gegenwärtig ist. Die Männer aber lassen augenblick-lich voneinander ab, setzen beschämt noch einen kurzen Wortwechsel fort, mehr um sich zu recht-fertigen, als um zu streiten, und gehen alsbald ihrer Wege. Der Polizist ist ein Jude. Die Männer, die eben noch gerauft haben, sind arme, einfache Arbeiter, Juden und Araber.
Wo in der Welt kann ein Handgemenge auf der Straße, ein zu Tätlichkeit ausgearteter Zwist unter {148} proletarischen Menschen derart geschlichtet werden? Mit einem Psalm.
Es ist wie eine Szene aus Bibelzeiten. Aus jenen Tagen, da noch König David hier oben saß in seinem Palast und Psalmen dichtete oder Salomo, der Sänger des Hohen Liedes. Es ist wie ein Auftritt aus Tausend und eine Nacht, wo der Khalif und der Lastträger einander Koransuren zitieren, um ihre Meinungen zu behaupten, wenn es um Leben oder Tod geht. Es ist Asien, das Geburtsland Gottes. Es ist der Orient, die Welt der Araber, die Heimat der Juden, wo das Ethos der Bibel noch nicht zur leeren Formel wurde, sondern immer noch warm und lebendig in allen Seelen atmet.
Der Polizist hat arabisch gesprochen und hebräisch. Im Tiefsten verwandt sind diese Sprachen einander, Mundarten eines Blutes und Stammes.
Das Hebräische war anderthalbtausend Jahre lang eine tote Sprache gewesen, das gleich dem Lateinischen und Altgriechischen nur in den Büchern noch existierte. Jetzt aber ist das Hebräische aufgewacht und jetzt ist es wieder eine lebende Sprache. Freilich, Latein und Griechisch mußten sterben, wie die Völker in Ohn-macht und Dumpfheit hingestorben sind, oder sich mit anderen spurlos vermischten. In der Ohnmacht der Juden aber lebte der Gottesglaube, lebte das gott-gegebene Ethos weiter, ohne Unterbrechung, als eine geheimnisvolle, durch nichts zu überwältigende Macht, und es lebte auch in ihrem Gebet, in ihrer unaufhörlich lebendigen Thora, manchmal nur halb verstanden, manchmal ihrem Wortbedeuten nach fast ganz {149} vergessen, das Hebräische weiter. Diese Sprache war nur scheintot.
Der jüdischen Art wohnt eine merkwürdige Kraft inne, Sprachen lange zu bewahren. So haben die aus Spanien Vertriebenen das Spanische (ldn-knigi: Ladino, Spaniolisch), die aus deutschen Ländern nach Polen Verjagten, die mittelhoch-deutschen Formen in ihrem Jargon und Jiddisch treu erhalten.
Das Jiddisch, dieser aus deutschen, polnischen, russischen und hebräischen, in den angelsächsischen Ländern auch aus englischen Sprachfetzen gemengte Jargon, war so stark geworden, hatte in einer ausgebreiteten Presse und in einer reichen Literatur solch eine hohe Kunstform erlangt, daß eine große Partei dafür kämpfte, Jiddisch zur allgemeinen Umgangs- und Unterrichtssprache für die Juden in Palästina zu erklären.
Aber das Hebräische war älter. Es erhob sich aus dem Pentateuch, aus den Büchern der Propheten und Richter, aus den Büchern der Könige und aus den Psalmen. Es war nicht die Sprache des Unglücks und der Erniedrigung, nicht die Sprache, die man in der Verbannung und im Ghetto erst gelernt und geformt hatte. Sondern es war die Sprache, in der Jahwe von Sinai herab sich vernehmen ließ, die Sprache des uralten Bundes mit Gott. Sie stammte aus den fernen Tagen der Freiheit; sie war eigenes Land, war Israels angestammter Grund und Boden diese Sprache.
Und wie das uralte, das jüdische Jerusalem hier unter dem Schutt, unter den Trümmern und unter den Bauten der nachfolgenden Geschlechter, {150} Zeiten und Völker begraben liegt, aber nicht tot ist, wie sein Herz noch schlägt und sein Geist noch atmet, so lag diese Sprache unter dem Schutt Jahrhunderte langer Erlebnisse und Leiden, atmenden Geistes und schlagenden Herzens. Sie lag unter den Trümmern zahlloser Hoffnungen und Träume, unter den Ge-danken, Bauten, die auf ihrem Grund errichtet waren. Aber sie lebte, sie richtete sich auf und sie war die stärkere. Sie stieg hervor aus ihrem Büchergrab, sie drang aus den Seelentiefen kleiner Ghettojuden. Und begann ihr Dasein wieder, in neuer Jugendkraft mitten unter der neuen Jugend des Volkes.
Dieses Erwachen habe ich schon vor zwanzig Jahren wahrgenommen, als mich, bald nach Herzls Tod, auf einer Vortragsreise in Krakau und Lemberg junge Studenten mit hebräischen Festreden begrüßten und als bei den Kommersen alle offiziellen Ansprachen he-bräisch gehalten wurden. Sie waren, gleich mir, der ich damals selbst noch ein junger Mensch gewesen bin, Söhne von liberalen Vätern, diese jungen Studen-ten, und sie hatten die Ideale, hatten die Hoffnungen und Träume ihrer Väter in einer Atmosphäre zer-stäuben sehen, die von Haß und hohnlachender Un-gerechtigkeit vergiftet war.
Sie besaßen die feine Witterung des Zukünftigen, die der Jugend gegeben ist und sie versammelten sich auf dem Boden ihrer uralten Sprache, wie ein Volk, das sich zu entscheiden-dem Verteidigungskampf bereitet, auf eigener Scholle sich sammelt. Viele von diesen Studenten sind heute hier in Palästina als Ansiedler. Einige von ihnen traf {151} ich da auf meinen Wegen. Und viele von ihnen haben heute selber Kinder, Halbwuchs, Heranreifende, denen das Hebräische schon Muttersprache geworden ist. Alle Juden in Palästina, woher sie auch gekommen sein mögen, formt das Hebräische hier zur Einheit. Und den Kindern, die hier das Licht der Welt erblicken, wird es im Elternhaus wie in der Schule zum Mutter-laut. Es steht, neben der englischen und arabischen Inschrift, auf allen Stationen der Eisenbahn, auf allen Straßentafeln und Erlässen, auf allen Drucksorten der Post und in allen Akten der Ämter. Wer von den Juden der ganzen Welt nach Palästina zieht, um hier zu leben, muß Hebräisch lernen, denn er bringt es nicht weiter, wenn er dies allgemeine Verständigungs-mittel nicht zu gebrauchen versteht. Das Erwachen einer Sprache aus tausendjährigem Schlaf könnte ein Wunder genannt werden und hat jedenfalls kein Bei-spiel in der Geschichte. Hier aber in Palästina ist das Beispiellose, ist das Wunder eine Alltäglichkeit ge-worden.
Dennoch ... dennoch, es bliebe bedenklich, wenn die Juden dadurch auch für sich zu jenem öden Nationalismus gelangen sollten, der die Barbarei und das Unglück so vieler Völker geworden ist. Nichts könnte die Juden dann davor retten, mit der hysterischen Anmaßung französischer Chauvinisten, mit der dummdreisten Engstirnigkeit deutscher Rassenfanatiker in einer Reihe zu stehen. Unrettbar würde jede selbstgefällige Überhebung den Sturz ihres Schicksals in Unfruchtbarkeit und Banalität zur Folge {152} haben. Sie wurden ja auch zu Bibelzeiten immer wieder klein, schwach, leicht besiegbar und elend, so oft sie von ihrem Gotte abgefallen waren und dem ewigen Bunde treulos, Götzen oder Fetische angebetet haben. Weit schlimmer und folgenschwerer wäre heute der Abfall von ihrer Erdensendung, die Untreue gegen ihre ethischen Gebote, der Wandel von einem reinen Volkstum, das die Liebe zur ganzen Menschheit in sich schließt, in ein Völkischsein, das eine Herausforderung an die Menschheit bildet. Von einem solchen Abfall gäbe es keine Rückkehr zu den alten erlauchten Al-tären der Seele, und solch eine Untreue fände kein Verzeihen, denn das jüdische Volk hätte sich selbst für immer aufgegeben.
Doch die Gefahr ist gering. Die Zeit, in der die Juden andere Völker bekriegt haben, ist seit Jahrtausenden vorbei. Es war die Kinderzeit des Judenvolkes. Und sie haben es nicht gewußt. Sie lebten umringt von Götzen-anbetern und mußten unter ihnen ihren einen, ihren einzigen Gott, mußten sich selbst behaupten. Seither haben sie in der Welt, die den Judengott anbetet, eine furchtbare Schule durchgemacht. Und sie wurden mit Hilfe dieser Schule, die freilich ohne Beispiel ist, ihrem tiefsten Wesen, wurden der Erfüllung ihrer Erden-mission genähert.
Wenn die Juden auserwählt sind, hat ihnen diese Auserwähltheit so viel Demütigung, so viel Pein, so viel Verfolgung, unstete Heimatlosigkeit und ein solches Riesenmaß von Jammer gebracht, daß in ihrer Rasse ein überheblicher Stolz nicht aufzukommen vermag. {153} Sie sind das einzige Volk, bei dem Glaube und Geburt, Blut und Gottgedanke unzertrennliche Einheit be-deuten. Dafür haben sie, freiwillig und gezwungen, mit zu vielen Leiden, mit zu großen Opfern zahlen müssen, als daß es ihnen nach so unendlichen, nach so bitteren Erfahrungen in den Sinn schleichen könnte, sich eitler Selbstgefälligkeit hinzugeben. Ihr Ver-langen geht nur dahin, dieses ungeheure, ungemein harte Schicksal, das so zäh, so ausdauernd und mit so viel Vitalität getragen worden ist, nun auch mit innerer Würde zu tragen. Und inneres Gleichgewicht, die Vor-aussetzung jeglicher Würde, suchen die Juden im Land ihrer Väter, das immer noch ihr Land der Ver-heißung ist.
Dieser Erdenfleck, den sie Heimat nennen, den Händearbeit, Taglöhnerfron, zu ihrem Eigentum machen soll, diese Scholle, auf der sie fester stehen können, als auf irgend einem andern Boden der Welt-kugel, wird ihnen Gleichgewicht geben. Ihnen, die hier sich abmühen und darbringen, um Palästina aufzu-bauen und allen anderen Juden, die von ferne mit-helfen, daß Palästina aufgebaut werde.
Ein geringes Beginnen, wenn man diesen kleinen Landstrich betrachtet, der kaum größer ist als das kleine Niederösterreich, kaum umfangreicher als eine englische Grafschaft. Ein enormes Unterfangen, wenn man die Lehren der Geschichte schätzt, die Übermacht der Widerstände, das Verstreutsein der Juden über die ganze Welt und ihre Zerrissenheit untereinander.
In der Klemme dieses grotesk-tragischen {154} Doppelsinnes gibt es keinen Raum für nationalistische Narre-tei, noch für nationalistischen Größenwahn. So wie die Teilnehmer an einem Wettbewerb, Läufer, Renn-fahrer, Diskuswerfer, all ihre Kräfte zusammennehmen, ihren Atem, das Funktionieren ihrer Muskeln, ihres Herzens und die Sicherheit ihrer Gelenke, so wie ein Künstler, der ein Werk vollbringt, alle seine Gaben versammelt, seine Fähigkeit des Schauens, seine Kraft sich zu konzentrieren, seinen Griff, mit dem er ge-staltet, so müssen die Juden jetzt alle ihre Kräfte zu-sammenhalten, ihr Erlebnis, ihre Ausdauer nach Niederlagen, ihre Gabe, in der Bedrückung aufrecht zu bleiben, ihre Natur, die sich immer wieder von jeder Knechtschaft befreit hat. Aber so wenig ein im Wett-kampf Ringender daran denkt, sich der Meisterschaft zu rühmen, die er eben erst erlangen will, so wenig ein inbrünstig um das Werk bemühter Künstler auf sein Genie pocht, das sich, vielleicht, erweisen, aber auch versagen kann, so wenig Anlaß und noch weniger Neigung hat das Judenvolk zu törichtem Nationalstolz, jetzt, da es in Erfüllung seiner größten Aufgabe erst am Anfang des Anfanges steht.
Die Perspektiven, die das Schicksal den Juden öffnet, reichen bis an den Urgrund der Menschheit, und alle Aspekte des heutigen Geschehens sind erhaben. Doch den Menschen, die unter solchen Aspekten hinwandeln, ist es unmöglich, hochmütig oder herausfordernd zu sein. Ihre Rasse konnte sich mit allen Rassen Europas mischen, nichts hat den jüdischen Geist, nichts die jüdische Art der Weltanschauung gewandelt oder auch {155} nur verdünnt. Erst wenn dieser geheimnisvolle, dieser erdhafte, durch Jahrtausende lebendig fortwirkende Zusammenhang mit der Bibel zerrissen würde, müßten die Juden aufhören, Juden zu sein.
Aus der Bibel kommt ihnen die Art, das Gute um des Guten willen zu tun, eine Sache, der Sache zuliebe. Sie ist ihnen so selbstverständlich geworden, diese Art, wie das Blut, das in ihren Adern kreist. Und sie ist ihnen zugeströmt aus dem Gebot der Sinai-Offenbarung, darin es heißt: 'Ehre Vater und Mutter, auf daß du lange lebest und es dir wohlergehe auf Erden!" Kein Ver-sprechen, kein seliges Jenseits. Keine Belohnung im Himmel. Nichts, als in der unendlichen Kette der Ge-nerationen ein Glied sein. Die eine Hand den Eltern gegeben, die andere Hand den Kindern. Zugleich Vater sein und Sohn, Mutter und Tochter. Als Einzelwesen seine Tage hinbringen, und vergehen. Nur in den kommenden Geschlechtern weiterleben, wie die Vor-eltern in uns gelebt haben. Unsterblichkeit, jawohl! Doch eine Unsterblichkeit auf Erden. Aber sie als Gotteslohn zu empfinden, sich damit als einzigen Gotteslohn zu begnügen, braucht es den eingeborenen Hang zum Guten um des Guten willen.
Niemals kann in hochmütige Feindseligkeit gegen andere Völker das Volk vertaumeln, dem Moses das Gebot eingeprägt hat: 'Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst."
In der Schule der Verbannung, durch die sie gegangen sind, darin sie blutigen Haß erlitten haben, grausame Verfolgung und erbarmungslosen Druck; in dieser unvergeßlich furchtbaren Schule sind die Juden {156} zum Mitleid erzogen worden, sind geläutert worden zur Duldung, zur fühlenden Anteilnahme an der Qual aller Kreatur, am Los der Verfolgten und Bedrückten. Es ist der tiefe Sinn, der jener Prüfungszeit innewohnt, daß die Juden eben durch sie zu einem freien, fried-lichen Menschentum gelangten. Es hat einen wunder-bar tiefen Sinn, daß sie mehr, viel mehr Unglück er-leben mußten und immer noch erleben müssen, als alle Nationen der Erde. Sie hielten im Unglück fest an ihrem Ethos, fest an den Geboten, die ihnen im Blut wohnen; und so erheben sie sich, über alle nationa-listischen Grenzen, zu einem Weltgefühl, darin jede Angriffslust schweigt, und darin jede Herausforderung, die nationaler Größenwahn so gerne übt, fremd bleibt. Der Geist des Verstehens ist bei ihnen, der Wille, die Menschen zu achten, und die Bereitschaft, ihrer Ver-söhnung zu dienen. Wie ein alter Mann, der durch Leiden weise und durch Weisheit gütig wurde, ist dieses alte Volk heute in seinem Denken und in seiner Seele.
Aber niemand kennt die Juden, niemand versteht sie. Sie haben kein anderes Ziel, als daß diejenigen, die heute ihre Feinde sind, ohne etwas Wirkliches von ihnen zu wissen, sie endlich einmal kennenlernen. Nation!
Was ist Nation? Eine Zeit wird kommen, über kurz oder lang, aber unaufhaltsam kommt sie und die ersten Zeichen ihrer Morgenröte stehen schon am Hori-zont: eine Zeit, in welcher Verfolgung um der Rassen willen und nationale Kriege so undenkbar sein werden, wie heute Inquisition und Religionskriege.
{157} Wenn man überall damit beginnt, die Juden zu be-trachten, statt sie, wie jetzt, zu beschimpfen, ohne sie je mit ruhigem Blick angeschaut zu haben, wenn man sich entschließt, sie zu verstehen, statt sie, unkundig ihres Wesens, zu verfolgen, sich allgemein verpflichtet fühlt, von ihrem Schicksal, von ihrem Ethos etwas zu wissen, sich nicht mehr berechtigt glaubt, sie blindlings zu verachten oder zu hassen, dann, ja dann schreibt die neue Zeit ihr erstes Datum in das Buch der Mensch-heitsgeschichte.
{158}
XVII
Klagemauer. Oft bin ich hierher gegangen. Von der strahlenden Höhe des Tempelplatzes in diesen Winkel des Elends. Aus dem farbigen Flimmern des Lebens in den Bazargassen, zu dieser traurigen Einsamkeit. Von dem blühenden Land da draußen, von der Ge-genwart, der Jugend, die gleich der Erde keimt und arbeitet, hierher, wo die Steine monoton vom Ver-gangenen reden und die Herzen der Menschen zu Stein werden.
Niemals und nirgendwo gab es ein Gleiches. Mit 'niemals und nirgendwo" hebt jedes Kapitel der Historie an, die das Schicksal der Juden erzählt. Niemals und nirgendwo ein Volk, das so gründlicher, so oft wiederholter Vernichtung widerstand. Niemals und nirgendwo ein Volk, das in Jahrtausenden zerstampft, zertreten, gefoltert, ausgerottet wurde und immer noch da ist, immer noch mit so lebendiger Kraft zu dulden vermag, zu leiden, zu hoffen und ... zu revoltieren. Niemals und nirgendwo ein Volk, das seine Sprache, verloren und totgeglaubt, neu erweckt. Niemals und nirgendwo ein Volk, das nach achtzehnhundert Jahren des Vertriebenseins in sein Land heimkehrt. Und nie-mals gab es, nirgendwo gibt es eine Stadt, deren {159} Zerstörung nach achtzehnhundert Jahren immer noch so bitterlich beweint wird mit solchen Ausbrüchen ver-zweifelten Schmerzes, wie man einen blutsverwandten Toten beweint, den man soeben sterben sah und der nun ausgestreckt daliegt.
Sie stehen hier in dieser Enge, die kahl ist und trostlos wie ihr eigenes Herz, die beschränkt ist und ohne Ausgang, wie ihr starrer Messiasglaube. Es bleibt gerade so vergeblich, an ihrem Glauben zu rütteln, ihm einen Durchblick ins Gegenwärtige oder Künftige zu geben, wie es fruchtlos bleibt, an dieser Mauer zu rütteln oder durch sie hindurch ins Freie schauen zu wollen.
Sie stehen da und weinen. Gewiß, es sind manche unter ihnen, die eine unwürdige Bettelkomödie auf-führen. Doch es sind ihrer nur wenige. Ihre Armut ist fürchterlich und sie gleichen den Kirchenbettlern, die ihre Blöße an den Pforten der Kathedralen zur Schau stellen, um von der Andacht Tribut zu fordern. Sie aber sind rührender als jene Bettler vor den Kirchentüren, denn sie schmiegen ihr eigenes, ihr win-ziges, rasch vergängliches Unglück an das ungeheuere Unglück ihres Volkes. Und wie oft ich sie auch sah, wie oft ich ihre kleine erbärmliche Komödie erkannte, die eben hier einen unbewußten Zug ins Große empfing, ich konnte nicht entrüstet sein und mein Herz konnte ihnen nicht zürnen.
Andere gibt es, die aufrichtigen Gemütes trauern. Aber sie weinen um sich selbst, sie beklagen ihr eigenes Los, sie schluchzen über ihr eigenes zerstörtes {160} Leben. Wie sollte man nicht Teilnahme für sie emp-finden, da sie das persönliche Verhängnis mit dem Verhängnis ihres Volkes vereinigen? Der Untergang Zions steht als Sinnbild des eigenen Untergehens vor ihrer Seele. Immer und überall setzt ja der Mensch sein eigenes kleines Selbst in Beziehung zu den Ge-schehnissen und Schauplätzen der Natur, wie der Ge-schichte. Diese armen Leute hier tun nur, was alle Sterblichen zu tun gewohnt sind. Vollständig aber ist der egoistisch-persönliche Tropfen wohl auch bei den Wenigen nicht auszuschalten, die hier wirklich nichts anderes beweinen, als den Fall des Tempels.
Herrgott, wie weinen sie!
Ihre Tränen beginnen schon zu fließen, wenn sie den schmalen Gang herangekommen und die aufragen-de Fläche der Mauer erblicken. Ganz nahe treten sie heran. Das Gesicht zur Wand gekehrt, sehen sie niemanden und die ganze Welt scheint ihnen zu ver-sinken, ist ihnen gar nicht mehr vorhanden, ist ihnen gleichgültig. Schluchzen schüttelt ihren Leib, während sie dastehen, das Auge an die Mauer geheftet, auf die Stelle, die ganz dicht vor ihnen ist; Wehlaute unter-brechen und zerreißen das Murmeln ihrer Gebete und Schreie der Verzweiflung machen dem Gebet ein Ende, um eine hemmungslose Trauer austoben zu lassen, die jeden Tag immer aufs neue wieder beginnt. Sie streicheln die alten Steine mit den Händen, sie pressen ihre Wangen zärtlich an die sonnenwarmen Quadern und bedecken sie mit heißen Küssen der Leidenschaft und der inbrünstigen Zärtlichkeit.
Alte Männer, die den {161} Erzvätern gleichen, sah ich in dieser verzweiflungs-vollen Andacht. Alte Weiber, den wüstesten Blocks-berghexen ähnlich, so daß ihr Anblick, wie der Anblick ihrer Ekstase kaltes Grauen erregte. Junge Männer, in der Fülle der Kraft und in der Fülle des Wohlstandes. Jünglinge, im Erblühen ihres Lebens. Junge Frauen, die hübsch waren und, wie man trotz ihrer Trauer merken konnte, verwöhnt. Und alle weinten, schluchz-ten, schrien hier vor dieser Mauer; zitterten, wenn sie die Steinquadern mit ihren Händen, Wangen, Stirnen und Lippen berührten.
Es sind Menschen in den bun-ten Trachten von Marokko, Algier, Ägypten, aus den Ländern der Levante, aus dem Yemen, oder Juden im Kaftan und im Zerrbild europäischer Gewandung, wie man sie aus den Ghettonestern Polens, Rußlands und Rumäniens kennt. Dann sind Schwerarbeiter da, Last-träger, Proletarier, die den alten Glauben noch nicht hinter sich geworfen haben. Manchmal kommen Pilgerscharen aus weiter Ferne, Männer, Frauen und Kinder, von ihren Rabbinern geführt. Sie lagern hier, mit ihren zu Bündeln geschnürten Habseligkeiten, ver-lassen vom Sonnenaufgang bis zum Sinken der Sonne die heilige Stätte nicht. Sie sehen nichts vom heutigen Jerusalem, wollen nichts davon sehen, wollen vom morgigen Jerusalem nichts hören und nichts wissen. Ihre Pilgerreise gilt einzig der Tempelmauer, gilt diesem einzigen Rest, der vom alten Jerusalem noch übrig geblieben, noch sichtbar und unberührt ist. Ge-meinsam erheben sie da ihre Stimme in Gebet und Klage und wenn sie dann einzeln in Ausbrüche wilden, {162} fassungslosen Jammers sinken, jeder von ihnen nach seiner Art und nach seinem Temperament, so ist doch der Jammer selbst ein Gemeinsames, das sie unterein-ander und mit der Mauer da verbindet.
In dieses schmale Becken hier schüttet die ganze Erde alles, was an Israel arm ist, und elend, unglück-lich und ... treu.
Kein anderes Wahrzeichen blieb aus jener Zeit zu-rück, in der das Judenvolk selbständig gewesen ist und frei, kein anderes, als dieser Rest einer nackten, kahlen Steinmauer. Sie steckt mit ihrem größten, ältesten Teil tief im Schutt des Bodens, steckt in anderen, dicht auf-einander gepackten Bauten. Nur der Teil da hier, dieser Rest, zeigt sich dem Tageslicht. Er steht da wie ein Überlebender nach furchtbarer Katastrophe, unkennt-lich in seiner Entblößung, unkenntlich durch die ent-setzlich veränderte Szenerie. Dennoch aber an seine vernichtete Größe erinnernd, in der immer noch auf-rechten Kraft seiner stolzen Haltung. Diese Wand aus Quadern, die sich aus dem Schutt hebt, von dem sie umklammert wird, aus den Häusermauern, die sie rechts und links bedrängen, steht da, wie ein Gefan-gener, den man wohl fesseln aber nicht überwinden konnte. Ihr großes, bleiches Antlitz hält sie dem Tag entgegen. Es ist selber eine stumme Klage, dieses Ant-litz. Mehr noch: ein Schrei! In der trostlosen Folge von Tagen und Nächten all der langen Zeit: ein Mahnruf!
Und am Fuß dieser Steinmauer öffnet sich Stunde um Stunde das Herz des Judenvolkes, strömt seine Klage hin, seine Reue und sein gläubiges Hoffen. Gott {163} mag in seinem Grimme den Tempel und die Stadt Davids der Zerstörung preisgegeben haben. Denn er ist überaus heftig in seinen zornigen Aufwallungen, dieser Gott. Er war es schon, zur Zeit der Wüstenwanderung, als er sein Volk, streng, ungeduldig und im Jähzorn strafend, aus Ägypten führte, er ist es wahrscheinlich immer noch und wird es wohl bis in alle Ewigkeit bleiben. Aber Israel verzagt nicht an diesem Gott. In den tiefsten Abgrund der Verzweiflung gestoßen, achtzehnhundert Jahre nach dem Fall, nach der Zertrümmerung des Heiligtums, nach dem Hin-gejagt- und Zerstreutwerden in alle Welt, kommt Israel immer noch hierher zu dem Stückchen Tempelmauer, und erhebt seine traurige, tränenerstickte Stimme empor zum Herrn.
Erstaunt blickt der Chaluz (Pionier, ldn-knigi) , der feiertags einmal hier-herschlendert, in das Gedränge der Klagenden. Die jungen Menschen, die aus Europa nach Palästina ziehen, das Land wieder aufbauen wollen, blicken un-willig und verwundert auf dies 'unfruchtbare Ge-wimmer". Sie glauben nicht mehr an Gott, nicht mehr an die Bibel; sie sind ganz frei, ganz modern. Nur an die eigene Kraft glauben sie, vertrauen einzig der be-freienden Macht sozialer Lehren und fühlen sich in diesem Schauspiel weinerlicher Passivität gedemütigt. Alle Tätigen, alle mit dem Leben Ringenden haben nur Abscheu und Ablehnung diesem 'Unfug" gegenüber, der so bald wie möglich überwunden werden und ver-schwinden muß. Denn die sich hier zu müßigem Jammer immer wieder versammeln, sind Feinde der {164} Aufbauarbeit.
Der Glaube dieser Menschen ist so starr und steinern wie die Klagemauer und so ganz unbe-weglich wie sie. Und dieser Glaube fordert, daß die Juden warten sollen, jedes Elend, jede Schande dulden und warten, die Hände im Schoß, bis der verheißene Messias niedersteigt, den Gott senden wird, die Juden aus der Verbannung wieder heimzuführen. Jedes eigene, jedes eigenmächtige Beginnen halten sie für Frevel, verdammen sie als sündhaftes Vorgreifen gött-lichem Willen.
Zwischen diesen beiden äußersten Gegensätzen spannt sich die ganze, ungeheuere Entschlußkraft, die ganze unbegreifliche Lebenskraft des jüdischen Vol-kes. Schicksal und Notwendigkeit sind diese beiden Pole einer dem anderen.
Damit der beflügelte Wille im Volk entstehen und seine Schwingen breiten könne, dieser feurige Wille, der sich mit stählerner Brust seiner Aufgabe entgegen-schleudert, mußte die zähe, unzerstörbare, niemals wankende Treue hier ausharren vor den Steinen der Tempelmauer. Hier ward die Kontinuität geschaffen, die keine andere erreicht an Dauer, diese Kontinuität, die in gerader Linie, unbeirrt durch alle Schrecken, von der Zerstörung Jerusalems bis zum Wiederaufbau Palästinas reicht. Die Aktivität der neuen Menschen ist nichts anderes als der in Bewegung, in Energie und Rhythmus aufgelöste, der nicht mehr starre Glaube, die nicht mehr unfruchtbare, sondern tätige Treue der Alten und Orthodoxen.
Lasse die überschäumenden Triebe der Jungen {165} wieder fest werden, verwandle ihr Denken wieder zu-rück in jenes abstrakte Grübeln, binde ihre Phantasie wieder an den Buchstaben der Verheißung und es er-gibt sich jener starre, jener unerschütterliche Glaube, an dessen steinernem Warten die Zeit stillsteht. Fremd schauen sie einander an, feindselig, erkennen sich nicht und sind doch Eins, sind Brüder, Söhne des gleichen Blutes, sind beide von der gleichen Mystik und Magie dieses Blutes durchströmt.
{166}
XVIII
Immer geht hier eine Gestalt neben mir, schwebt vor mir her auf den Straßen, winkt mir in so vielen Ab-bildern, von so vielen Wänden zu und lebt in meinen Gedanken: Theodor Herzl. Ich erinnere mich seiner, entsinne mich unserer Gespräche, wenn ich draußen in den Kolonien bin, die zu sehen ihm nicht mehr be-schieden war. Und so oft ich da in Jerusalem durch das Jaffator gehe, richtet seine hohe adlige Erschei-nung vor meinen Augen sich auf. Er steht da und wartet auf den deutschen Kaiser und es ist eine ganz andere, eine vollkommen veraltete Zeit. Jedesmal habe ich hier gerade am Jaffator die Vision dieses wunder-baren Mannes, der daran starb, daß er seiner Zeit so weit voraus war. Freilich, er hat auf einen Kaiser ge-wartet; aber er ist dennoch der Erste gewesen, auf dem Weg nach Jerusalem und er stand als Erster am Jaffator.
Er ist jetzt, zwanzig Jahre nach seinem Tode, noch ebenso lebendig, wie früher, da er auf Erden einher-ging. Die Kraft seines Wesens ist noch genau so in-tensiv, die Macht seiner Wirkung noch durchgreifender wie einst. Als er starb, viel zu früh und gar zu schnell, glaubte man, er sei mitten aus einer eben erst {167} begonnenen, aus einer lange hoch nicht fertigen Arbeit weggerafft worden. Ja, er selbst mag das gedacht haben, als er von hinnen schied. Und das kranke, müdgehetzte Herz hat sterbend noch für die unvoll-endete Lebensarbeit gezittert. Heute jedoch erkennt man, daß er ein vollendetes Werk hinterlassen hat. Voll treibender Säfte, durchglüht von einem leben-digen, weit um sich greifenden Feuer. In den zwanzig Jahren, die seit seinem Hingang verstrichen sind, haben sich die Nebeldünste verzogen, die das Schaffen eines jeden Menschen zu umschleiern suchen, und die den Erdenweg Theodor Herzls besonders dicht und trübend umwölkten. Hämischer Spott, gemeiner Neid, Zweifel-sucht, Verleumdung, Böswilligkeit, all das fiel zu Boden, zerging in spurloser Ohnmacht und immer mehr ward der Blick frei auf die reinen Linien einer tragisch schönen Gestalt.
Er war ein Mann der Feder und wurde ein Mann der Tat. Er fing als Dichter an und endete damit, seinen stärksten Dichtertraum in Wirklichkeit umzu-setzen. Er schien zu einem der eleganten, genießeri-schen Geister der Literatur bestimmt, und wurde der Märtyrer einer großen Idee. Er schien berufen, die nobeln, verwöhnten Leute mit der verwöhnten, nobeln Kunst seiner Feuilletons zu amüsieren, und er brachte seine Kunst, seinen komfortabeln, angenehmen Ruhm, sein Vermögen, ja, sein Leben den Ärmsten der Armen, den Bedrücktesten der Bedrückten zum Opfer.
( siehe Theodor Herzl 'Feuilletons' J. Singer & Co. Verlag, Berlin, 1911, Band I und II
Erzählungen, Reiseberichte, Philosophische Erzählungen; auf unserer Webseite; ldn-knigi)
Wäre es nicht seine Bestimmung und sein Schick-sal gewesen, daß er aus dem schönen, geistig {168} vornehmen Kreis, in dem er einer der Ersten war, her-austrat, um ein Erwecker und Führer seines Volkes zu werden, er könnte heute noch leben. Er wäre jetzt un-gefähr drei- oder vierundsechzig, und die edle Reife seiner kleinen Meisterwerke wäre jetzt noch edler, noch reifer und noch meisterhafter. In dem Triumvirat Speidel, Wittmann war Herzl der Jüngste und der Ge-schmeidigste. Ludwig Speidel war in seinem Wesen wie in seinem Stil der schweren, eichenstämmigen Art Gottfried Kellers verwandt. Hugo Wittmanns sorgsam gearbeiteter Plauderton war durchhaucht von der An-mut des achtzehnten Jahrhunderts. Theodor Herzl jedoch ist in seinem Talent ein Vetter Heinrich Heines gewesen. Er hatte den Blick für die großen Zusammen-hänge und für die kleine Komik des Daseins. Er hatte das Wissen um alle erhabenen Weisheiten der Men-schen wie um ihre erbärmlichen Narreteien und er pries die einen, entlarvte die anderen in Worten, die das Weise mit dem Närrischen überraschend ver-banden. Er hatte das Auge für winzige, aber charak-teristische Einzelheiten und er verstand die Zauberei, durch das Guckloch des winzigsten Details weite Per-spektiven in die Welt zu eröffnen. Er besaß die plastische Kraft der Anschaulichkeit. Mit zwei, drei Sätzen stellte er irgendeine Persönlichkeit des Tages hin, daß man sie leibhaftig zu sehen meinte. Zu sehen, wie sie in Wahrheit aussah. Denn er zeigte, wie sie auszusehen wünschte und riß ihr dann mit einer ein-zigen, fast liebenswürdigen Wendung die Maske ab, knipste ihr mit scherzhaften Stübern den Theaterputz {169} von Kopf und Schultern oder wusch ihr mit ein paar heißen, wahren Worten die Schminke vom Gesicht.
Er schuf Menschen, die wirklich existierten oder auch wirklich existieren konnten, und in seiner Schilderung hatten sie ein köstlich plausibles Leben. Die alten Bettlerinnen und die schönen Herzoginnen, die Staats-männer und die Hochstapler, die armen Gemüseweiber auf dem Krautmarkt in Brunn und die exquisiten Lebe-damen auf der Strandpromenade in Biarritz. Er zeich-nete die Figuren von Tieren und er malte Landschaften, er beschrieb die festliche oder die zornige Erregung einer Stadt und er formulierte den Wesenskern eines Buches. Das alles aber war leuchtend von Farbe, fun-kelte von Echtheit, hatte das ruhig gesicherte Gleich-gewicht des bis ins Innerste Durchschauten, und es sprühte vor Leben. Seine Sprache hatte rassige Schön-heit, sie war kokett und doch wieder ganz einfach. Diese Sprache war an französischen Akzenten geübt, an der Pariser Kunst der Pointierung geschliffen und in allen Künsten raffinierter Kultur heimisch. Der Orgelklang ihres Pathos wühlte die Seele auf und der feine Peitschenhieb ihrer Ironie hinterließ dünne, aber blutige Striemen.
Er war ein Feuilletonist, was heute für so viele, die in ihren Fächern ohne die scharfe Kontrolle der Öffentlichkeit dahinstümpern, eine Be-zeichnung ist, die sie ahnungslos und geringschätzig gebrauchen, was aber für die ganz Wenigen, die von der außerordentlichen Seltenheit dieser Gabe etwas verstehen, doch ein wenig mehr bedeutet.
{170} Theodor Herzl ist also ein Feuilletonist gewesen. Das heißt, er war fähig, jede Kunst und alle Künste an das Handwerk des Tagschreibers zu wenden; aber er war unfähig, in der Kunst zu handwerkern.
Dieser Künstler nun, der das Leben kannte wie wenige, der sich wie wenige darauf verstand, die Welt und das Leben nachzubilden, dieser Dichter, der die Kraft hatte, aus Eindrücken und Einfällen, die andere zu seichten Romanen oder Stücken ausspinnen, kleine Meisterwerke zu formen, die in ihrer knappen Ge-drängtheit an Fülle und Tiefsinn überreich waren, dieser Mann auf der Höhe des Erfolges, setzte sich eines Tages hin und schrieb die Broschüre 'Der Judenstaat", die denkwürdig geblieben ist.
Sie trug ihm zunächst das gehässige Spottgelächter aller reichen und satten Großstadtjuden ein, all dieser Flüchtlinge ihres eigenen Blutes, dieser entfärbten, banalen, selbstzufriedenen Sippschaft, die sich für ihr Geld Orden, Titel und Adelsbriefe gekauft hat, die in Snobbismus zerfloß, wenn sie von aristokratischen Pa-tronessen angesprochen wurde, und die sich einbildete, das Versöhnungswerk zwischen Juden und Christen sei restlos gelungen, wenn ein Graf ihre Tischeinladung annahm. Dann brachte ihm diese Broschüre den Schimpf all der Jünglinge und Jüngls, die aus Nikolsburg, Jicin oder Budweis in die Wiener Literaten-kaffeehäuser gekommen waren, und die es nun Herzl vorwarfen, er sei in Budapest geboren, als habe er damit eine Niederträchtigkeit begangen. In den besten Fällen hatte er noch das mitleidige Lächeln oder die {171} gutgemeinten, doch wohlfeilen Scherze seiner Freunde
und Bekannten auszuhalten.
Aber diese Broschüre wurde zum Wendepunkt im Leben Theodor Herzls und sie ist ein Wendepunkt in der Geschichte des jüdischen Volkes geworden.
Herzls Schrift erfolgte gewissermaßen als eine Art Antwort auf den damals hochanschwellenden Anti-semitismus der Luegerei. Aber das war nur ein äußerer, ein zufälliger Anlaß, und an der Größe, an dem Alter des ganzen Problems gemessen, möchte man sagen, daß es nur ein kleiner Anlaß gewesen ist. In den Blättern dieser Schrift erwachte ein stolzer, freier Mensch aus dem Angleichungstraum, den seit den Tagen der Henriette Herz und der Rahel Varnhagen so viele edle und gutgesinnte Juden geträumt haben. Er sah die zahl-losen, großen Leistungen der großen Männer seines Volkes in allen Ländern und auf allen Gebieten, sah die wertvollen, die kostbaren Beiträge, die dieses Volk zu allen Kulturen lieferte, und sah die Wand des Hasses, von der die Juden zurückgestoßen wurden, an der ihre heißesten Bemühungen zerschellten.
Er wollte nicht mehr um eine Zugehörigkeit werben, die ja doch immer und immer wieder höhnisch ver-weigert wurde. Theodor Herzl hatte, als Student, den Schimpf des Waidhofener Programms erlebt, das den Juden die Waffenehre absprach; er sah die Kluft nur immer weiter und tiefer sich öffnen, und sein Gedanke war, daß Versöhnung nur werden könne, wenn die Juden sich zu ihrem eigenen Volkstum bekannten, zu {172} ihren uralten Überlieferungen und zu ihrem uralten Lande.
Geschrieben steht: 'Meine Rechte verdorre, vergeß ich Dein, Jerusalem!" Er rief wieder nach Jerusalem. Nicht die Großstadtjuden, nicht die Reichen, auch nicht die in irgend einem Heimatboden Verwurzelten. Aber die Armen, die Verfolgten, die Unterdrückten und Entrechteten, die Masse des Volkes in Polen, Rußland, Rumänien, die ewig Vertriebenen, die Heimatlosen, die beständig von den Tragödien der Pogrome dezimiert wurden. Dieser Ruf nach Palästina war die Auflehnung einer nobeln, empfindlichen Seele gegen die stumpfe Gehässigkeit Europas. Dieses Bekenntnis zum eigenen Volk war der Bruch mit den gangbaren Ideen, in denen die westlichen Juden hinlebten. Herzl betrat damit den Boden, den unsichtbaren, aber sicheren und schwellend reichen Heimatboden der Bibel. Er war durchströmt von der ungeheueren Vergangenheit, von der strengen und reinen Ethik seines Volkes, und wie der Sohn der Erde, Antäus, unüberwindliche Kräfte empfing, so oft er die Mutter berührte, wuchsen auch ihm neue Ströme von Kraft, da er den alten hei-ligen Mutterboden der Bibel berührt hatte.
Er war sich der Folgen, die das Erscheinen des 'Judenstaats" haben werde, klar bewußt. In seinen Tagebüchern, die ein so eindruckvolles, manchmal aber auch ein so verwirrendes Bild seiner Persönlich-keit und oft eine so deprimierende Zeichnung seiner Zustände geben, ist das genau zu lesen. Er wußte voraus, daß die Juden des Ostens, von seiner Botschaft {173} erweckt und hingerissen, mit Begeisterung zu ihm stehen, daß die akademische Jugend seines Volkes auf seinen Ruf sich um ihn scharen werde. Er sah den Anfang einer großen, einer immer weiter um sich greifenden Bewegung voraus. Sie hatten der heiligen Stadt nicht mehr gedacht in ihrem täglichen Wollen, nicht mehr in ihrem beständigen Streben und ihre Rechte war kraftlos geworden, war verdorrt. Jetzt aber werde die Arbeit ihrer Tage, das Sehnen ihrer Nächte wieder um Jerusalem gehen und in ihrer Rechten wird Entschlußkraft aufs neue erblühen. Er wußte das vorher und er wußte auch, daß er nun aus der Lite-ratur eintrat in die Geschichte.
Er führte die Bewegung, er hielt sie fest in seinen Herrscherhänden, er wuchs an ihr, an seinem eigenen ins lebendige Leben gebauten Werk. Er hatte alle die bezaubernden Vorzüge der großen Führer, wohl auch die Schwäche, daß er fortan nur unbedingte Anhänger kannte oder böswillige Widersacher. Nach diesem Ge-sichtspunkt änderte sich fortan sein Verhältnis zu den Menschen, stellte sich ganz nach diesem Gesichts-punkt ein. Er konnte es nicht sehen, wollte es nicht sehen, wie er nach seinem meisterhaften Können ge-schätzt, mit welcher Auszeichnung er behandelt wurde. Er stand im Kampf und er kämpfte, mit Tapferkeit, mit Erbitterung, mit grobgesponnenen Intrigen, mit feinster staatsmännischer Kunst, mit offenem Visier und in allerlei Masken.
Er kämpfte gegen Türken, Christen und Juden. Am meisten aber gegen Juden. Könnte er heute aufstehen, sehen, wie die von ihm {174} entfachte Bewegung über das enge Strombett des Zio-nismus hinausgetreten und fast alle Juden der Welt irgendwie ergriffen hat; könnte er sehen, wie das Heilige Land von jüdischen Siedlern wieder fruchtbar gemacht wird; vernähme er die Botschaft, mit welcher der Völkerbund das alte, historische Recht des jüdi-schen Volkes in Palästina anerkannt hat, er wäre stolz in dem Bewußtsein, nicht vergeblich gelebt zu haben. Und erführe er, wie leicht die Juden Unsummen für alle möglichen Zwecke hergeben, wie schwer aber und wie zögernd und wie wenig für ihre eigene Sache, er würde sein bitterstes Lächeln lächeln und leise vor sich hinsagen: 'Daran erkenne ich sie!"
So sehr lebendig ist er heute, zwanzig Jahre nach seinem Tode, daß er immer noch mitten unter uns zu weilen scheint und daß seine Meinungen sich erraten lassen. Sein Bild ist an allen Wänden, in den Sied-lungen, in den Schulen in Palästina. Überall wo Juden sich vereinigen, ist dies Bildnis vor ihnen, dieses erlauchte Haupt eines Beduinenscheichs, mit den schwarzen, schwermütig schönen Mandelaugen, dem schwarzen Bart und den beseelten Zügen eines Künstlers.
In Tel Awiw, der neuen Stadt am Meeresufer, trägt die Hauptstraße seinen Namen, das Gymnasium ebenso, und eine Olivenpflanzung bei Jerusalem heißt Herzl-Wald. Seinen Namen trägt das Hotel, das auf der Höhe des Berges Karmel erbaut wurde. Und auf den Schwingen seines weiter und weiter in die Zukunft schwebenden Ruhmes werden {175} auch seine Werke, seine Bücher von Generation zu Generation getragen.
So kann es niemals vergessen werden, daß es ein Dichter war, der die Befreiung des jüdischen Volkes unternommen hat.
{176}
XIX
Wieder hinaus ins Land. Der Morgen ist frisch, bei-nahe herbstlich kühl und in kaltem Stahlblau glänzt der Himmel über Jerusalem.
Natürlich fahre ich wieder mit Chaim Mandelbaum. Doch ich kann diesmal nicht vorne neben ihm sitzen, denn er hat auf meine Einladung seinen kleinen Sohn mitgenommen, ein hübsches Kind von fünf Jahren, das sich rasend über den Ausflug freut, aber viel zu manierlich und bescheiden ist, um seine Freude laut werden zu lassen. Und Chaim Mandelbaum freut sich ebenso kindlich, daß er seinen Jungen neben sich hat. Er sagt nichts, nur seine Augen lachen.
Diesem Manne gehört meine ganze Sympathie. Klein und zierlich von Gestalt, mit dem klugen, wachsamen Gesicht eines Marders, ist er sanft und verwegen, leidenschaftlich und voll Sachlichkeit. Er hat die besten Manieren, wie sie nur einem Menschen von wirklichem Herzenstakt gegeben sind. Er ist be-scheiden, doch ohne jede Devotion; er ist fast zärtlich, jedenfalls ganz behutsam in der Form, aufmerksam und fürsorglich zu sein; aber er wahrt immer Distanz und wird sich nie etwas vergeben. Auf unseren Fahrten hat er, wie oft, den Kontakt zwischen Leuten, mit {177} denen ich sprechen wollte, hergestellt und ist dann jedesmal, wie von ungefähr verschwunden. Immer wieder mußte ich ihn von neuem auffordern, mit mir an einem Tisch zu essen. Er wußte, daß ich es ein für allemal so haben wollte. Dennoch ließ er sich's jedesmal erst ausdrücklich sagen, und ließ mir dadurch die Freiheit, einmal nicht in der Laune zu sein. Er fing nie von selbst ein Gespräch an, weder bei den Mahl-zeiten, noch wenn wir im Auto nebeneinander saßen, aber er nahm das angebotene Gespräch unbefangen auf, er sprach klug und, ohne Redseligkeit, gegen-ständlich. Wenn wir irgendwo in einem Zelt zusammen übernachteten, war er gefällig, lautlos und gleichsam unsichtbar.
Er erinnerte mich in seiner wirklich feinen Art, der Geselle einsamer Streifzüge zu sein, an manche Jäger, mit denen ich in Bergrevieren tagelang allein war und mit denen ich in irgendeiner Hütte genächtigt habe. An manche Jäger, sage ich, denn nicht alle hatten so tadellose Manieren und solch vollendeten Takt wie Chaim Mandelbaum. War er zufrieden, und er war es immer, wenn er sah, daß ich mich wohl befand oder daß ich starke Eindrücke empfing, dann lächelten seine Augen und ein leises, nettes Lächeln spielte um seinen Mund. Ich mochte diesen Ausdruck gerne. Als Chauffeur besitzt Chaim Mandelbaum eine Meisterschaft und eine Bravour, wie nur wenig andere. Wie ließ er das Auto den schlechten steilen Weg nach Sebastije erklettern, wie unvergleichlich lancierte er den laut keuchenden, schwer arbeitenden Wagen droben durch das immer steiler werdende Labyrinth des {178} engen, von Häusermauern umstellten Dorfpfades, der sich mit brüsken Wendungen in Sebastije berg-auf dreht, und der oft genug auch noch von Arabern, Frauen und Kindern, von Kamelen, Eseln, Rindern und Schafen versperrt wurde. Wie mustergültig voll-führte er dann die Talfahrt, auf demselben spott-schlecht gehaltenen Weg, der, nur die Spur eines Weges, halsbrecherisch bergab stürzt, hart am Rand jäher Hänge vorbei.
Niemals, wenn ich neben ihm saß, verließ mich das Gefühl vollkommener Sicherheit, so ruhig, so sicher und beherrscht hatte er sich selbst und das Auto in der Gewalt. Man sagte mir, er sei in Indien Chauffeur des deutschen Kronprinzen gewesen. Er bestätigte es auf in eine Frage, stellte nur richtig, er habe als Chauffeur eines Maharadscha den Kronprinzen gefahren, wäh-rend dieser beim Maharadscha zu Besuch weilte. Fertig. Er erzählte nichts von Indien, nichts vom Kronprinzen. Chaim Mandelbaum ist keine Plaudertasche. Und er spricht überhaupt nur von Palästina, er interessiert sich nur für den jüdischen Aufbau, er lebt und fühlt nur für dieses Werk.
Sein Vater kam von irgendwo her, aus dem euro-päischen Osten, aus Polen oder Rumänien, nach Jeru-salem, wo Chaim und seine Geschwister geboren wurden. Der Vater lebt noch, ein beweglicher, freund-licher alter Mann, der manchmal, ehe wir auffuhren, an den Wagen trat, um mich zu begrüßen. Er hat Glück mit seinen Söhnen, der Alte. Sie sind in der weiten Welt, in Mexiko oder Südafrika, arbeiten und {179} gelangen zu Wohlstand; sie denken an Heimkehr und kaufen Häuser in Tel Awiw. Chaim Mandelbaum aber, der schon früher weit umhergekommen ist, bleibt nun in seiner Vaterstadt, hat sich in Jerusalem ansässig ge-macht und ist Motorfuhrwerker. Er besitzt einige Automobile und hat ein paar junge Chauffeure enga-giert. Er gehört zu den jüngeren Leuten, steht etwa in Mitte Dreißig, aber er ist kein Atheist; er hat die Frömmigkeit und die konservative Gesinnung, die man in alten Familien findet und die ihn so wenig wie andere, vernünftige Leute hindert, Schritt zu halten mit der Gegenwart.
Er ist die Verkörperung des tüch-tigen, anstelligen und arbeitsamen Elements unter den Juden, jener Leute, die sich bescheiden und würdig stets in ihren Grenzen halten, die niemals mehr und niemals klüger scheinen wollen, als sie sind. Mir war es eine Freude, ihn getroffen zu haben. Denn seine Art und seine Existenz straft angenehmer Weise so vieles Schlechte Lügen, das den in Palästina alteingesessenen Juden nachgesagt wird.
Heute fahren wir durch das Kidrontal, fahren am Garten Gethsemane vorüber. Bethanien liegt dann nahe zur Seite und unsere Straße geht von der erreichten Höhe des Ölbergs, immer hinunter. In breiten Kehren, in geraden, sacht sich neigenden Einschnitten, wo der Blick durch vorliegende, steile Bergrücken gehemmt ist, über hohe Sattelstraßen, von denen man weit ins Land vorausschauen kann. Auf den grünkahlen Hän-gen weiden in Herden Schafe, Ziegen und Rinder. Hie und da zeichnet sich die von flatternden Gewändern {180} umhüllte Gestalt eines Hirten auf dem Höhenrand in das eintönige Himmelsblau. Beduinen, die den Weg kreuzend, von der einen Bergseite heruntergesprengt kommen, die andere Seite wieder durchs Gestein hinan-galoppieren. Sonst Einsamkeit und tiefe Stille. Nur das Kreisen eines Adlers da und dort im Äther.
Auf der Plattform einer Kuppe, dicht an der Straße, die Ruinen einer Kreuzfahrerburg. Unter der Türken-herrschaft war ein Teil davon bewohnbar gemacht und diente der Straßenpolizei als Station. Jetzt ist alles in Trümmer gefallen.
Das kümmerliche Grün verschwindet, je weiter wir fahren. Es gibt keine Herden mehr. Die Berge sind kahl, nackte Mergelsteine und lehmiger Sand, fahlgelb, laugenhaft, tot. Auch in den Lüften kein Adlerflug. Die Natur ist hohlwangig geworden, unheimlich leblos, scheint wie unter einem Fluch erstarrt. Darüber das helle Lachen der Sonne in der Eintönigkeit des blauen Himmels läßt die Szenerie noch gespenstischer er-scheinen.
Abzweigung rechts. Da liegt ein welliges Hochtal und in mäßiger Entfernung sieht man Häuser und Kuppeln von Moscheen, dicht beisammen, fahlgelb, wie der Boden, blinkend im Sonnenlicht. Der dünne, lange Finger eines Minaretts zeigt aufwärts. Das ist Nebi Musa, der Ort, an dem, nach den Überlieferungen des Islams, Gott seinen Propheten Moses begraben hat. Alljährlich um Ostern versammeln sich Zehntausende von Mohammedanern in Jerusalem und ziehen in {181} feierlieber Andacht zum Grabe Mosis, nach Nebi Musa. Sultan Salah-ed-Din hat diese Wallfahrt angeordnet und seit das Gebot besteht, wird es treu befolgt bis zum heutigen Tag. Der gewaltige Aufmarsch von Mo-hammedanern, die sich um Ostern immer hier ver-einigen, sollte den österlichen Zustrom christlicher Pilger nach Jerusalem balancieren. Heute geht diese Prozession als Drohung gegen Christen und Juden vor sich.
Wir halten und schauen hinüber, nach Nebi Musa. An alten Stätten, die das Christentum oder der Islam heiligt, ebenso, wie an denen der Juden, empfinde ich den Kern von Wahrheit, den der Glaube birgt, verehre ich die Wirklichkeit, die der Glaube zu erschaffen ver-mag. Nur hier weigert sich mein Gefühl, hier wider-strebt mein Sinn.
Zu fest ist das Bild des Mannes in meine Seele ein-geprägt, der sein Volk aus Ägypten, aus Erniedrigung und Sklaverei fortgeführt hat, zurück in das Land der Erzväter, in das Land der Verheißung. Unterwegs er-kannte er in seiner göttlichen Weisheit, daß die Men-schen, die von den Fleischtöpfen Ägyptens gegessen hatten, nicht fähig seien, das Land zu erobern, nicht tauglich, es in Freiheit zu besitzen. Erkannte, daß ein neues Geschlecht heranwachsen müsse, eines, dessen Nacken sich noch nie unter dem Joch der Knechtschaft gebeugt, eines, dessen Leiber noch nie die Peitsche des Vogts berührt hatte. Hier ist die höchste, ans Wunder streifende Leistung staatsmännischer, menschlicher Führerschaft. Sie schließt verzweifelt ab mit den {182} Zeitgenossen und baut ihr ganzes Werk auf die Zukünftigen.
Vom Ziel, das nach seinem Willen die Jugend nur erreichen darf, hält Moses sich selber fern. Der Ent-schluß, den er gefaßt hat, ein junges, freigeborenes Volk ins Gelobte Land zu führen, trifft ihn selbst, trifft ihn am härtesten, trifft ihn mitten ins Herz, das frei geboren, das groß und frei geschlagen von Jugend an, das Knechtschaft nie geduldet, das nur Aufruhr gekannt und die Sklavenketten seines Volkes zer-brochen hat.
Dennoch hält er fest an diesem Entschluß. Er sieht, nach vierzig Jahren Wüstenwanderung das Land derVerheißung nur von ferne. Zu den Füßen des Berges, auf dem er steht, allein mit sich und seinem Gott, lagert das Volk, das er herangewachsen sah, das er er-zogen und dem er ein Gesetz gegeben hatte. Die Kraft seines Geistes lebte in diesen jungen Menschen, seine Sitte, seine Zucht und der Schwung seiner Energie.
Sie ahnten nicht, daß er sie für immer verlassen hatte, daß er den Berg Nebo emporgestiegen war, um zu sterben.
Er aber schaute vom Gipfel die ersehnten Gefilde und löschte aus. 'Seine Augen waren nicht dunkel ge-worden und seine Kraft nicht verfallen." Er löschte aus, damit der Weg des Volkes frei werde.
Niemand hat eine Sache so vollkommen, so rein um ihrer selbst willen getan, wie er. Es gibt kein Entsagen, das so schmerzlich, so voll Selbstüberwindung, und so einfach war, wie das seinige. Es gibt {183} keine Hingabe und kein Selbstopfer von so ruhiger Größe.
Wundersam schließt die biblische Geschichte das letzte der Bücher Mosis, mit dem kurzen Bericht. Gott selbst habe diesen Toten bestattet, 'im Lande der Moabiter." 'Und hat niemand sein Grab erfahren, bis auf diesen heutigen Tag."
Zu fest ist die Erscheinung dieses göttlichsten und menschlichsten aller Menschen in meine Seele geprägt, daß ich nun gläubig der Kunde lauschen könnte, Gott sei von dem sublimen Gedanken, die Erdenreste Mosis ins Unbekannte zu entrücken, wieder abgeirrt, und habe den Propheten, zur vermehrten Bequemlichkeit tendenziöser Wallfahrer näher gen Jerusalem ge-bettet. Diese kleine Wendung ins kleinlich Greifbare paßt nicht zur herrlichen Strenge der geliebten Gestalt des Moses, fügt sich mit ihrem unschlüssigen Getue nicht zum ehernen Schritt seiner gewaltigen Lebens-geschichte. Das Märlein schmeckt nach Pfaffentrug.
Immer noch halten wir und schauen nach Nebi Musa hinüber, während mir alle diese Gedanken durch den Sinn gehen. Ich weiß freilich, wie zweifelhaft die Buchstabenwahrheit aller biblischen Ereignisse ge-worden ist. Auch weiß ich, daß es in der heutigen Welt Fragen gibt, die wichtiger sind, als die Frage, ob der Leichnam Mosis im Unbekannten, Geheimnisvollen oder dort drüben unter der Moscheekuppel von Nebi Musa ruht. Doch mir geht es nicht um die Buchstaben-wahrheit der Bibel, sondern um eine höhere Wahr-heit, deren unversiegliche Quelle die Heilige Schrift {184} ist. Schicksal und Reichtum, Tragödie und Heiterkeit, Sünde und Tugend der Menschheit sind in der Bibel enthalten. Sie werden nur wieder und wieder gelebt, wieder und wieder erlebt, wieder und wieder gedichtet. Das Höchste aber, was man seither von Erlebnis und Dichtung zu sagen vermag, ist, daß sie, manchmal, bis an biblische Vorbilder heranreichen. Niemals sind sie stärker, größer gewesen, hatten niemals mehr Essenz des Blutes, als in der Bibel. Wenn diese Begebenheiten nur Gleichnisse bedeuten, dann sind die Ereignisse, die wir mit Augen sehen, gänzlich nichtig. Ich hänge an diesen Gleichnissen ... aber warum spreche ich von mir? Nur weil ich hier auf der Wegkreuzung halte und nach Nebi Musa hinüber blicke? Die ganze Menschheit hängt an diesen Gleichnissen, bewußt oder unbewußt, gewollt oder wider Willen. Sie ist ihnen unlösbar verknüpft, sie hat die Inhaltsfülle dieser Gleichnisse bis heute nur erst geahnt, hat sie nicht ausgeschöpft, noch weniger sie überwunden und wird die Vollendung nicht früher erreichen, als bis sie Eins geworden ist mit der unerbittlichen Schönheit dieser Gleichnisse. Ich habe nichts zu suchen in Nebi Musa.
Wir fahren weiter durch die traurige öde des Mergel-gebirges. Da weitet sich das Land tief unter uns. Der Spiegel des Toten Meeres blinkt aus fahlgelben Ufern. Drüben heben sich in Nebelbläue die Berge von Moab, und ein dichter Waldstreif säumt auf dem Grund der Landschaft, vom Norden nach Süden laufend, die Ebene dort unten: der Jordan.
Der Wagen rollt zwischen niederen Sandhügeln, {185} schließlich zwischen Erdbuckel nur, wie unter einem Haufen durcheinander geworfener, großer Bettpölster. Der Boden funkelt und blitzt oder trägt einen weiß-lichen Schorf. In Gruben steht noch Wasser. Es schimmert fett, regenbogenfarbig. Kein Gras, kein Busch entwächst dieser bleichen, zerrissenen, zer-beulten und zerstückelten Erde, die mit Pottasche, mit Salz bedeckt ist, wie mit einem Ausschlag. Nur hie und da ein Distelstrauch, bleich, entfärbt, von der Sonne gedorrt. In einigen der Löcher findet sich Druckwasser vom Toten Meer. Andere sind von Beduinen gegraben, die Salz für ihren Bedarf gewinnen wollen.
Der Wagen stolpert und holpert durch diese Trost-losigkeit, neigt sich nach vorne, sinkt in die Hinter-räder, schwankt zur Seite, rollt und stampft wie ein Schiff im Sturm. Nach der herrlichen Gebirgsstraße, die wir herunterkamen, sind wir im Weglosen. Rad-spuren, in den Sand gedrückt, zeigen manchmal die Richtung. Aber dieser Boden behält Spuren nicht lange. Sumpfige Stellen müssen wir umfahren. Sie gehören zum Inundationsgebiet des Toten Meeres, das zur Regenzeit über seine Ufer schwillt. Manchmal ist das Umfahren nicht möglich. Dann geht's eben mitten durch; beständig in der Gefahr, stecken zu bleiben.
Es ist sehr heiß geworden. Denn wir sind aus einer Höhe von achthundert Metern über dem Meer weg-gefahren und befinden uns nun etwa vierhundert Meter unter dem Meeresspiegel. Nach der fröstelnden Frühlingsluft gemäßigter Zone, die man jetzt in Jeru-salem atmet... Tropenklima. Endlich zeigt sich {186} wieder so was, wie eine Straße. Wir machen eine sachte Kurve, gelangen aus den Buckeln, Löchern und Sümpfen heraus und halten am Toten Meer.
An der nördlichsten Bucht dieses Sees stehen wir. Der Blick, der südwärts über die graue Fläche hin-streift, verliert sich in der Horizontlinie, wo Himmel und Wasser einander berühren. Die Berge Moabs, die über anderthalbtausend Meter ansteigen, heben sich schroff vom Ostufer. Hinter einer langhingestreckten Schirmwand üppig grünenden Dschungels rauscht der Jordan, mündet lebendig ins Tote Meer und stirbt darin. Die Fische, die unvorsichtig schwimmen oder von der Strömung fortgerissen in die Stickflut geraten, verenden augenblicklich. Immer liegen etliche von ihnen, mit blinkender Schuppenflanke, angeschwemmt am Ufer, das so tot ist, wie das Tote Meer.
Dieser Platz da ist traurig und wie verflucht. Eine Hütte steht hier, auf Piloten, aus elenden Brettern zusammengenagelt, mit schwarzem Dachpix gedeckt. Leere Konservenbüchsen liegen verstreut. Kisten stehen zum Verladen geschichtet. Denn ein Dampfschiff fährt von hier zum Südende des Toten Meeres. Die Leute, die da in der Hütte wohnen, sind wie Verbannte. Traurig und menschenscheu. Und das Schiff wirkt, als diene es, von Charon gelenkt, zur Überfahrt ins Jenseits. Daß der Blick hinüberreicht zu dem grünen Leben des Jor-danbettes, zu den grünen Hängen der Moabiter Ge-birge, läßt die Verfluchtheit dieser Stelle noch. trost-loser erscheinen.
Das Wasser, das sich vor uns unendlich dehnt, ist {187} durchsichtig und klar. Taucht man aber die Hände ein, wirkt es unangenehm fettig und sonderbar schwer. Wer es kostet, nicht etwa schluckt, nein, nur in den Mund nimmt, spuckt es schnell wieder aus, angeekelt von dem salzigen Laugengeschmack, der lange noch beißend an Gaumen und Lippe haftet. Keine Wasser-pflanze wächst auf diesem Grund, kein Lebewesen regt sich in diesem riesenhaften Becken. Kein Insekt tanzt spielend über seiner trägen Fläche. Kein Vogel fliegt über dem Spiegel dieses Sees.
Sodom und Gomorrha, die beiden blühenden, reichen Städte, die hier gestanden, sind mit ihrem Gebiet in der Blüte und im Reichtum ihrer Sünden vernichtet und spurlos vertilgt worden. So tief schlug sie die Faust des Herrn in den Boden, daß wir da auf dem tiefsten Punkt der Erde wandeln, im Einriß, in der Narbe jener Wunde, die Gottes Zorn der Welt zugefügt hat. Aber aus Pech und Schwefel, aus Salz und Asche, darin die Ruchlosigkeit der armen Menschen erstickt wurde und erstarb, beginnt nun die Technik Schätze zu heben, an Asphalt, Brom, Magnesium, Natrium und Kali. Wir fahren fort vom Toten Meer und ich gestehe, daß ich ein Gefühl der Erleichterung habe. Die trüb-selige Szenerie drückt mich nieder. An sich und in dem furchtbaren Gleichnis, das sie vorstellt. Diese erstarrte, wie in Verzweiflung entseelte Natur, die keinen Atem holt, hat mit der atmenden, herrlichen öde der Wüste nichts gemein und ist deprimierend. Soll sie Zeugnis ablegen von Gottes Zorn, dann schäme ich mich dieses {188} Ausbruches von Jähzorn und seinen Opfern gehört meine Teilnahme. Immer habe ich ein Empfinden schmerzlich peinlicher Scham im Anblick einer Zer-störung, die von Anfällen des Jähzornes verübt wurde. Mag die Zerstörung ein einzelner Mensch oder ein ganzes revoltierendes Volk angerichtet haben und mag der Einzelne oder das Volk noch so sehr im Recht gewesen sein. Nur mit Scham vermag ich die Niedermetzung der Schweizer Garde nach dem Tuileriensturm zu lesen; nur mit peinigender Scham sah ich die Verwüstungen; die Revolutionäre und Legionäre während der Umsturztage begangen haben. Das er-barmungslos zerstampfte Leben, das nun zum unkenntlichen Leichnam geworden ist, um Kehricht, ruft mein Erbarmen an. Vielleicht mit dem Hauch des letztes Schreckens, des letzten Todes-Entsetzens, der die leblosen Reste noch umwittert. Wie sollte ich im Anblick seiner Spuren nicht Scham empfinden über den Zornausbruch Gottes?
Dei Wagen stolpert wieder über Erdlöcher, balan-ciert über Sandbuckel, glitscht durch Sumpfstellen und gelangt endlich, nach langer Fahrt in üppig grünendes Gestade. Wir sind am Jordan.
Zwischen dem Dickicht der Ufer rollt die rasche Strömung erdbraune Wellen, denn ihr Bett ist sandig weich und das in starkem Gefälle niederspringende Wasser wühlt den Schlamm vom Grund. Eine Lan-dungsstelle ist da, für Boote, dabei eine kleine Wirt-schaft, von Griechen gehalten. In die Wipfel der Bäume und an die Matten der Hauswände sind plump {189} mit Schilf ausgestopfte Wildschweine gehängt, die man hier im Uferdschungel schießt. Es sind kleine, blondfarbene Tierchen. Vor Zeiten sollen Löwen im Jordan-wald gehaust haben, doch vielleicht waren das auch nur Panther oder größere Wildkatzen, die angeblich heute noch dort gesichtet werden.
Es ist idyllisch hier und anheimelnd; es ist tropisch heiß, doch nicht heißer als an einem Julitag in den Auen der Donau. Wir rudern im Kahn auf dem Fluß, der hier viele Windungen vollführt und das ergibt reizende Veduten. Die Vegetation steigt in dichten Schilfrohrbüscheln aus dem Wasser, hebt sich in Mastixsträuchern, in hellgrünen Weiden und in schlank aufragenden Pappeln an den Uferböschungen. Libellen schweben mit ihrem zuckenden Tanz über den Wellen, Bienen und Hummeln brummen, Käfer surren, Schmetterlinge gleiten im Taumelflug durch die Luft. Im Dickicht aber schwirren und flattern, pfeifen und zwitschern zahllose Vögel. Hier soll die Stelle sein, wo Jesus von Johannes die Taufe empfing. Fromme, christliche Pilger baden hier in Sterbe-kleidern.
Wir gelangen an die Furt, die das Juden-volk, von Josua geführt, durchschritt. Alles ist wie damals. Alles war damals hier wie heute. Unzählige Generationen von Schilf, Weiden und Pappeln sind an diesem Ufer aufgewachsen und hingeschwunden. Die Wasser des Flusses rauschen eilig dahin, wie je. Der Strom menschlicher Entwicklung, der seit jener Zeit, dreitausend Jahre lang hinrollte, vermochte an der Jordanlandschaft nichts zu ändern. Die Natur lebt {190} hier zu kraftvoll und selbständig, als daß sie vom Treiben der Menschen so leicht berührt werden könnte.
Wir machen uns auf und fahren durch die Ebene nach Jericho. Wir kommen an Gilgal vorbei, der ersten Raststätte des Volkes, das den Jordan über-schritten hatte und ins Land gebrochen war. Wohl mochte es ihnen scheinen, daß Milch und Honig in diesem glücklichen Gefilde fließe. Denn selbst heute, da der schwellende Boden unbebaut und vernachlässigt ist, merkt man, wie reich und fruchtbar er sein kann und wie verhältnismäßig geringe Mühe durch üppige Ernte gelohnt würde. Ein herrlicher Obstgarten könnte diese Ebene sein, die sich da unter einem Tropen-himmel wohlig in der Sonne breitet. Gewürze, selten und kostbar, müßten hier gedeihen. Aber die Schrift menschlicher Arbeit ist auf dieser schönen Tafel fast verlöscht. Nur Weidegründe, mit wildem Klee be-standen, werden von Beduinen benützt. Ein grie-chisches Kloster hegt einsam etliche Felder und ein christlicher Siedler wohnt in seinem Fruchtgarten, dessen Baumwipfel wie ein Eiland aus der Ebene ragen, weithin sichtbar.
Was aber ist aus der Palmenstadt Jericho geworden? Mitten in Palmenwäldern lag sie; in ihren Gärten blühte der Balsamstrauch, und alles Korn auf den Feldern reifte hier früher, viel früher als in den Bergen. Die Palmen sind verschwunden, bis auf wenige, die erst in neuester Zeit gepflanzt wurden. Niedergehauen die hochragenden Bäume, vergeudet und vertan der {191} Reichtum, mit dem die Natur diesen Erdenfleck be-gnadet.
Heute ist Jericho ein armseliges kleines Arabernest, flach und offen, auf flachem Grund gesetzt. Beduinen lagern am Saume seiner Straßen und geben sich dem-selben adeligen Müßiggang hin, dem auch die Bewohner Jerichos huldigen. Dennoch sind sie wohlhabend, die Beduinen da und die Araber von Jericho. Sie wären große Herren, wenn sie arbeiten würden. Das alte, biblische Jericho liegt ein wenig weiter nach Nord-osten. Am Rand des Berges unter der frisch sprudeln-den Quelle Elischa. Man geht die Allee entlang, die vom neuen Jericho zu den Ruinen führt. Villen vor-nehmer Leute aus Jerusalem schmücken diese Allee und die Besitzer verbringen hier den Winter, der auch in Jerusalem kalt ist. Kleine Landgüter sind da. Es reifen die Trauben hier schon im Sommer, Bananen gedeihen üppig und es würden die Dattelpalmen, die Kokospalmen, alle Früchte Indiens hier gedeihen, wenn man sie hegen wollte. Strotzend liegt die Erde und wartet der Hände, die sie bebauen.
Mächtig und melancholisch ragen die Mauernreste des alten Jericho über der ewigen Jugend der Elischa-quelle. Hier starb Herodes, der letzte große Gewalt-mensch, der diesem Land entsprossen war.
Schlaffes, süßes Träumen umfängt mich in der Sonne und im Blühen von Jericho. Niemals habe ich in Palästina diesen beglückten Zustand erlebt, dies Hingeschmiegtsein an die zärtliche Umarmung der Natur, dies nahe Spüren ihrer milden, magischen Kräfte, {192} dieses Sorgloswerden und tiefe Atemholen, ohne Sehn-sucht, ohne Heimweh. Lange saß ich und sah den Arabern zu, die ruhig dasaßen und in die Luft schauten.
Dann, im Wagen, als die Straße wieder steil zum Gebirge anstieg, wandte ich mich noch einmal, um auf die Jordanebene niederzublicken und auf Jericho. Ein Paradies ist hier verlorengegangen. Neugeschaffen, kann ein Paradies hier erstehen.
Das Auto klettert die Serpentinen höher und höher. Bergkuppen fächern sich zusammen, schieben sich aus-einander. Plötzlich, im Ausschnitt zweier Gipfelprofile, auf dem felsigen Scheitel eines Berges das märchen-hafte Bild einer Festung, mit Zinnen, Türmen, Kuppeln, von der Abendsonne beglänzt. Auf meinen entzückten und verblüfften Ausruf 'Was ist das?" lächelt Chaim Mandelbaum: 'Jerusalem - die Bergstadt!"
{195}
XX
Man muß in Palästina auf das Kleine, Unscheinbare achten. Die Vergangenheit spricht hier nicht in großartigen Tempelruinen, wie in Ägypten, nicht aus den Trümmern marmorner Architekturen und vorbild-licher Kunstwerke wie in Griechenland oder Italien. Da steht eine alte Zisterne und sie ist ein Brunnen, der in der Bibel genannt wird. Dort ein Steinhaufen und die Überlieferung nennt ihn das Denkmal eines wunderbaren Ereignisses.
Den ganzen Boden bedecken Erinnerungen über Erinnerungen. Wir fahren aus Je-rusalem, am Jaffator vorbei, durchs Hinnomtal, den Dschebel Abu Tor hinan, und kommen über die Hoch-ebene Rephaim, wo David die Philister schlug. Hier ist Davids Land. Hügelauf und hügelab durch grünendes Getreide gelangen wir nach Bethlehem in Davids Heimat. Die sanfte Ruth hat hier gelebt, auf diesen Fluren. Und, nahe von Bethlehem, dessen Häuser man schon an der Berglehne sieht, liegt dicht an der Straße Rahels Grab. Hier zogen die Erzväter, weideten die Herden auf den üppigen Triften, die von der Wüste umschlossen sind.
Nach Bethlehem saust man hinauf und das ist, als produziere man sich in einer Arena. Die breite Kehre, {194} die dem Berg umgelegt ist, als ein Gürtel, läuft gerade, und drüber steht, im Abstand, die Stadt mit ihren Häusern aufsteigend, gleich den Galerien einer Arena, füllt den Spalt des Berges, und während man die Straße hinrollt, ist es, als ob die vielen Fenster Augen von Zuschauern wären. Dann wendet sich die Straße jählings bergwärts und man wird von den engen Gassen Bethlehems umschlossen.
Sie ist im Binnenland die prächtigste und reichste Stadt und es kann nicht geleugnet werden, daß sie einen gewissen Hochmut zur Schau trägt. In ihren Häusern ebenso, wie in ihren Menschen. Die Häuser sind fast alle aus Quadern errichtet, glänzen weiß und rein in der Sonne und sehen wohlhabend, stattlich, manchmal sogar vornehm aus. Begüterte Landwirte sind ihre Bewohner oder glückliche Händler mit An-denken und Heiligenbildern. Denn es gibt geschickte Steinschneider hier, die aus dem schwarzen Asphaltstein, der in der Gegend von Nebi Musa, gegen das Tote Meer gefunden wird, Amulette, Reliefmedaillons oder Statuetten meißeln. Hier ist Arbeit und Segen der Arbeit.
In Bethlehem leben fast ausschließlich Christen. Sie haben sich diese Stadt errungen, in den Kreuzfahrer-kriegen, in den Kämpfen gegen Hebron, in den Schlachten mit den Fellachen und Beduinen, und sie sitzen nun seit Jahrhunderten ungestört hier. Die Frauen tragen noch den Henning, den weißen, schräg nach rückwärts zugespitzten Kopfputz des Mittelalters. Nirgendwo anders tragen Frauen diesen Kopfputz. Der {195} sagt: ich bin aus Bethlehem. Er macht die Trägerinnen überall, wo man sie in Palästina trifft, als Bethlehemitinnen kenntlich. Sie bilden eine Aristokratie, diese Frauen von Bethlehem. Es sind kraftvolle, breite, oft ganz dicke Weiber, stolz in ihrer Haltung, streng in ihren Mienen. Oftmals auch schöne Weiber, und sie prangen fast alle in der Fülle der Gesundheit. Aber ein Marienantlitz habe ich nicht unter ihnen entdeckt.
Irgend eine Straßenwendung, ein Anblick, ein Steig zwischen Häusern, die behaglich sind, weht für Sekundendauer Erinnerung an tirolische Gebirgsstädtchen durch den Sinn. Etwa: Sterzing am Bremer. Dann aber sind weite Plätze da, flimmernd in weißen Steinquadern und man ist wieder im Orient.
Die Geburtskirche betritt man, indem man durch eine kleine Öffnung an der hohen glatten Mauer schlüpft. Dann kommt man in einen Vorhof und von da erst an das Kirchentor, seitlich vom Hochaltar.
Eine schöne, alte Basilika, oft zerstört, oft wieder re-stauriert. Hoch oben an den Wänden des Mittelschiffs Reste von Mosaikfresken, prachtvoll in den verblaßten Farbentönen. Der Raum wirkt durch seine Leerheit imposant. Nur wenig Anteil haben die römischen Katholiken an dem Besitz dieser Kirche; noch weniger die Armenier. Der Hauptteil gehört den Griechen.
Da ich eintrete, sitzt ein griechischer Geistlicher vor einem Tischchen an der Türe und ißt sein Mittagmahl. Fleisch mit Kohl. Auf der erhöhten Estrade vor dem freistehenden Hochaltar treiben ein paar junge Priester und ein Soldat ihren Scherz mit einem weißhaarigen {196} Geistlichen, der sich in bester Laune necken läßt, munter umherspringt und die klatschenden Schläge ins Genick, die ihm zum Spaß versetzt werden, lachend hinnimmt.
Der Herr, der zu Mittag ißt, bedeutet mich, zu warten. Es sei unmöglich, jetzt in die Krypta hinunter-zusteigen. Aber die Andacht, die eben stattfinde, werde bald zu Ende sein.
Ich gehe in der Kirche umher, die so erfreulich an-zusehen ist und an manche alte Kirchen Venedigs er-innert. Mit einemmal tönt Gesang, schwebt mit Kinder-stimmen, silbernd zart um mich. Niemand zu sehen. Die Kirche, die über dem Stall erbaut ist, darin Maria ihr Kind gebar, die Kirche scheint nun selbst, am hellen Mittag mit Kinderstimmen zu singen. Eine Weile dauert das geheimnisvolle Lied, das scheinbar keinem Menschenmund, zum mindesten keinem sicht-baren, entströmt. Dann schwillt der Klang voller an, dringt näher und nun steigt eine Schar kleiner Mäd-chen aus der Krypta, geführt von einem Priester, zieht in Prozession durch die Kirche, dann zum Tor hinaus.
Ein paar Stufen, eng und steil nach abwärts, und ich stehe in dem kleinen, dunkeln, nur von sanften Lampenschein bestreuten Raum unter dem Hochaltar. Hier ist die Stätte, an der Jesus geboren wurde, der Platz, der die Anbetung der Hirten sah und das Er-scheinen der heiligen drei Könige. Hier lag die junge Mutter im Stroh. Und da stand die Krippe, die dem Kind als Wiege diente. Alles ist genau bezeichnet und kenntlich gemacht.
{197} Eine sehr feine Empfindung hat den Prunk kost-barer Opfergeschenke von hier ferngehalten. Der Schmuck dieser Stätte ist kunstlos, aber wohltuend ein-fach. Ergriffen fühle ich hier die unerschöpflich holde Schönheit der beiden Gestalten: Mutter und Kind. Ewig und lieblich zugleich sind sie beide. Es gibt nichts schuldloseres in der Welt, nichts, das so zu allen Herzen spricht. Welch eine Werbekraft, als den armen, entgötterten Menschen der sinkenden Antike von Mutter und Kind erzählt wurde, die auserwählt waren und arm. Welch eine Seelenwärme drang damit un-widerstehlich in die Gemüter, die erkaltet verzweifelten, weil der Glaube an die reichen, satten, glücklichen Olympier keinen Trost mehr bedeutete.
Aus dem schwachen Zwielicht der Krypta, aus dem milden Dämmer der Kirche, der schattenkühlen Vor-halle wieder in die starke Sonne und man ist im Ge-sicht, an Brust und Rücken wie angerührt, wie ge-streichelt von linder, zärtlicher Hand.
Man träumt hier nicht. Weder in Bethlehem, noch auf der Weiterfahrt nach Süden, durch das Hochland gegen Hebron. Man sinkt hier nicht offenen Auges in wunschlosen Gedankenschlummer.
Man ist aufgewacht, fühlt die Munterkeit aller Sinne, man könnte jauchzen oder Melodien pfeifen, wäre man nicht von einem heiteren Ernst davor zurückgehalten und ich glaube, man könnte beten.
{198}
XXI.
In breiten Bergwellen steigt das Gelände. Die Luft ist würzig und belebender als in den Niederungen von Jericho.
Hier ist jüdischer Urboden. Da lebten die Erzväter, lange vor der Sklaverei in Ägypten. Abraham hat hier oben den Bund mit Jahwe geschlossen, im Eichenwald Mamre. Es ist kein Wald mehr da, nur auf den Berg-höhen um Hebron ragt hier und dort neben anderen Wipfelriesen ein vereinzelter Eichbaum. Aber der Bund besteht noch, wie damals. Hier lebte Isaak und segnete Jakob, während Esau in den Tälern und Klüf-ten der Gebirge auf Jagd ging. Hier zerriß Jakob seine Kleider, im Schmerz, weil er glaubte, wilde Tiere hätten Josef, den geliebten Sohn verschlungen.
Und von hier fuhr er auf goldenem Wagen zu dem wunder-bar Wiedergefundenen, der nicht mehr hochmütig war, sondern weise. Sie fuhren damals fast alle auf goldenen Wagen in die Fremde, die ihnen Knecht-schaft wurde. Und sie sind viel später erst heimge-kehrt, nach langer Sklaverei, nach einer vierzig-jährigen Wanderung durch die Wüste, nach einer Zeit der Prüfung, der Reife, und der geoffenbarten Gebote. Sie sind dann noch einige Male verjagt {199} worden, im Laufe der Jahrtausende und sie kommen heute wieder, angezogen vom Magnet des uralten Bun-des, der seine Kraft noch nicht eingebüßt, herbeige-trieben vom Lockruf des uralten Landes, das seinen Zauber noch nicht verloren hat.
Da schimmert Hebron inmitten prangender Wein-berge, die am höchsten gelegene Stadt Palästinas, fast tausend Meter über dem Meeresspiegel. Eine von den ältesten Städten der Erde. Hier fanden die Kund-schafter, die über den Jordan ins Land schlüpften, noch das Riesengeschlecht der Enakskinder und von den Weingärten brachten sie eine Traube, die so groß war, daß sie von zwei Männern auf einer Stange ge-tragen werden mußte. Hebron wurde der Sitz des jüdischen Volkes. Denn hier war es, vor Zeiten, wo Abraham die Höhle Machpela vom Hittiter Ephron zur Gruft erwarb, seinem Weibe, sich und den Sei-nigen.
In Hebron ward David zum König gekrönt. Hier residierte er, ehe er Jerusalem gewann. In Hebron verschwor sich Absalom gegen den königlichen Vater und unter dem Torbogen der Stadt fiel Abner von Joabs Schwert.
Alle diese Erinnerungen und viele, viele andere dazu werden lebendig, da ich durch die Stadt gehe. Es ist eine strenge, feierlich schöne Stadt und das Groteske an ihr besteht darin, daß sie ein Ghetto hatte. Auch diese Vaterstadt der Juden... ein Ghetto! Alle Gedenk-namen hier sind jüdisch, alle Stätten hier, die heilig sind, wurzeln in der jüdischen Bibel. Aber zwischen {200} diesem erinnerungsreichen Boden und dem Volk, das ihm verknüpft geblieben, schob sich der Islam und hütet die Spuren der Vorväter drohend gegen die Nachkommen. Wenn es nicht derselbe Gott wäre, den alle verehren, wenn es heute nicht gleichgültig bliebe, wer die heiligen Stätten pflegt, es müßte aufreizend sein, daß die Juden von ihren Heiligtümern getrennt sind.
In der Höhle Machpela liegen Abraham, Isaak und Jakob begraben, neben ihren Frauen Sarah, Rebekka und Lea. Urväter und Urmütter der Juden, mehr als zweitausend Jahre bevor Mohammed lebte und bevor es Mohammedaner gab. Dennoch darf kein Jude die Moschee betreten, die gleich einer Festung über Mach-pela steht, darf keiner zur Höhle niedersteigen, den Staub der Patriarchen zu grüßen. Wer es dennoch tut, ja, wer es nur versucht, dem mag es dann schwerlich gelingen, Hebron lebendig zu verlassen.
An der ummauerten Treppe, die zum Eingang der Moschee emporführt, erwarten dich Derwische und Ulemas und wehren jeden weiteren Schritt. Wilde, fanatische Gestalten, junge und alte. Sie haben eine zu-dringliche Höflichkeit, die devot und herrisch zugleich ist. Sie fordern Bakschisch, aber in ihren dunkeln Augen lodert Fanatismus und Gewalttat. Sie belauern jede deiner Mienen und Gebärden, brechen ohne An-laß in komödiantische Empörung aus, doch jeder ein-zelne von ihnen, alt oder jung, ist bei einer Bewegung, die er mißversteht, bereit, dir den Dolch zwischen die Rippen zu setzen. Die Komödie würde zum blutigen {201} Ernst und keiner wäre bereit, den 'Schützer des Heiligtums" zu verraten. Da man in diesen Dingen kein Fanatiker ist, da man längst begriffen hat, daß es lächerlich und töricht ist, sich gegen Ortsbrauch aufzulehnen, wie toll er auch sein mag, vor allem aber, weil man sein innerstes Fühlen an solcher Stätte durch einen läppischen Streit mit unwissenden Leuten nicht stören, noch verletzen will, ist man friedlich, gibt Bakschisch nach allen Seiten und fragt: 'Was ist also erlaubt?"
Da umringen alle dich, führen dich sieben Stufen die Treppe zum Eingang der Moschee empor, diese Treppe, die etwa dreißig oder vierzig Stufen ansteigt, halten dich an beiden Armen fest und lassen dich dann durch ein Mauerloch in das tiefe Dunkel eines unter-irdischen Gewölbes schauen. Man sieht nicht viel. Man steht auch nicht lange vor dem Mauerloch, denn es ist lästig, an den Armen festgehalten zu werden, in-dessen ein paar mangelhaft gewaschene Herren einem den Rücken belagern. Ich wende mich rasch, befreie mich unwillig und bin am Ausgang, noch ehe sich die Gesellschaft von ihrer Überraschung erholt hat. Einen Augenblick stehen wir uns so gegenüber. Die Gruppe drinnen, an der Treppe, und ich draußen, vor dem Eingang. Ich gebe zu erkennen, daß meine Ge-duld zu Ende ist. Die Herren scheinen zu überlegen, ob sie sich auf mich stürzen oder ob sie nett sein sollen. Sie entschließen sich dazu, nett zu sein und sind plötzlich für die Idee begeistert, mich rund um die Moschee zu führen. Ich bin gereizt durch die {202} körperliche Berührung, die mich von Fremden immer erbittert, und lehne ab. Nun werden sie demütig, schildern mir die Herrlichkeiten dieses Rundganges, versprechen mir einen Blick in den innern Hof und auf die Kuppeln, die unmittelbar über der Höhle Machpela sich wölben. Gut! Gehen wir. Aber - mit erhobenen Stock wird's ihnen gesagt - zwei Schritt vom Leib. Wir steigen die hohe Umfassungsmauer hinauf. Wir stehen oben und ich genieße einen freien Blick auf das wellige Hochland rings um Hebron. Zu den weißen, niederen Kuppeln im Hof der Moschee schaue ich nur ganz flüchtig nieder.
Und doch: es ist die Höhle Machpela, die hier zu meinen Füßen liegt. Ich stehe am Grabe der Erzväter. Diese Erdenstelle da unten birgt den Staub des milden Abraham, des gehorsamen, vom Gehorsam nieder-gebeugten Isaak, den Staub Jakobs, der mit dem Engel gerungen und den Namen Israel erworben hat.
Am Ursprung meiner Art bin ich hier, umweht von den Schauern einer endlosen, einer unerhört gewaltigen Vergangenheit, die mir angehört und der ich mit un-zähligen Fäden verknüpft, bin. Ich muß lächeln, während ich halb im Scherz und halb im Ernst über-lege: Ein Nachkomme von Abraham bin ich, ebenso wie diese Araber hier, die bloß Nachkommen Ismaels sind, des Sohnes der Hagar. Ich dagegen bin ein Nach-komme Abrahams und Isaaks und Jakobs. Sie aber dürfen mich fernhalten von der Höhle Machpela, dürfen jedes Gefühl, das sich an dieser Stätte in mit {203} regen will, stören, und dürfen noch Bakschisch dafür verlangen.
Wieder muß ich lächeln. Es bleibt schließlich gleich-gültig, wer diese Heiligtümer hütet.
Man muß wirklich her nach Hebron kommen, um am Grab der Erzväter dem sonderbaren Verhältnis, in das sich die Völker alle zu den Juden gesetzt haben, ein Gleichnis zu finden. Sie legen unsere Quellen mit Beschlag und lassen uns nicht herantreten. Sie er-richten auf unseren heiligen Fundamenten ihre Heilig-tümer und führen uns außen um die Mauern. Wenn sie gut gelaunt sind. Und wenn wir Bakschisch dafür zahlen.
{204}
XXII
Zwischen Hebron und Bethlehem auf grüner Höhe fährt man seitab der Straße eine geringe Strecke. Dann ist man auf einer Halde und hier liegen, gestuft, einer unter dem anderen, drei gemauerte Teiche. Die Le-gende berichtet, König Salomo habe sie angelegt und von ihnen sei das frische Trinkwasser der nahen Quelle nach Jerusalem geleitet worden. Dann sind diese kolossalen Behälter ganz von Schlamm erfüllt gewesen. Das Wasser, das darinnen stand, wurde grün von den Sumpfpflanzen, von denen auch die steinernen Wände des Bassins moorig überzogen wurden. Und viele Frösche lebten in der eingedickten Jauche, Blut-egeln, Schlangen und Molche. So vergingen viele Jahr-hunderte, vergingen mehr als zweitausend Jahre.
Als dann die Engländer Palästina erobert hatten, machten sie mit den Teichen des Königs Salomo ein wenig Ordnung. Es war eigentlich nichts weiter zu tun, als die Teiche auszuputzen und die Quelle wieder zu fassen. Aber niemand hatte das besorgt, diese ganze lange Zeit her, in all den Zeitaltern, die verstrichen sind, niemand.
Die Engländer jedoch wollten das gerne besorgen. Und sie besorgten es. Warum sollten sie das schöne {205} Werk des guten, alten Salomo nicht wieder in Gang setzen? Und sie setzten es wieder in Gang. Ganz einfach.
Heute sprudelt die Quelle in einem niedlichen Häus-chen, das ihr errichtet wurde. Das Wasser steht wieder in den Teichen und ist so himmlisch rein, daß man bis auf den Grund sehen kann. Da sieht man denn auch, daß sie wahrhaftig so alt sind, wie der Tempel Salomos. Denn die mächtigen Quadern ihrer Wände und ihres tiefen Bodens zeigen die gleiche Art der Bear-beitung wie die unteren Quadern der Tempelmauer.
Ein Drahtzaun ist rundherum und eine ständige Wache ist auch da.
Weil sie nämlich drinnen, in Jerusalem, seither wieder dasselbe Quellwasser von hier trinken, wie einst, da König Salomo noch regierte.
Es ist reizend, hier umherzugehen und sich zu freuen.
Aber die Selbstverständlichkeit, mit der die Fäden wieder genau dort geknüpft werden, wo sie unter dem Einbruch des Titus zerrissen sind, das Ungeheuere einer solchen Kontinuität, wird, wenn man sich eine Weise besinnt, zu einer seltsamen, märchenhaften Wirklichkeit, die überwältigt.
{206}
XXIII
In der Ebene Iezreel liegt Siedlung bei Siedlung. Man überblickt den grünen Teppich dieser Ebene, wenn man vom Süden, aus den Bergen Samarias herkommt, oder wenn man aus dem Norden von den Höben Galiläas talwärts fährt. Zwischen diesen beiden Gebirgszügen breitet sich die Ebene Iezreel, teilt sie entzwei, streicht nach Nordwesten und dehnt sich, je näher sie dem Meer entgegenblüht.
Hier unten sieht man von einer Siedlung die Dächer der anderen. Tel Adas ist nahe an Balfouria, das sich schon an den Fuß des Berges Tabor schmiegt und dessen Felder die höher schwellenden Anfänge des Hanges bedecken. Von dem südlicher gelegenen Merchawja schaut man nach Tel Adas und Balfouria. Von überall aber nimmt man Nahalall wahr.
Fast überall in den Siedlungen hier betreibt man Einzelwirtschaft. Da gibt es keine sozialen Experi-mente, keine Theorien noch Programme, die Weltordnung zu ändern oder zu bessern. Jeder Ansiedler hat so und so viel Dunam Boden, die auf fünfzig Jahre sein Eigentum sind. Jeder besitzt sein Haus, das er sich errichtet hat, besitzt seinen Stall für das Vieh, seinen Inkubator, um Hühner zu züchten, seine Bienenstöcke {207} und seinen Speicher. Wie in anderen Dörfern, wie in Europa ist die Dreschmaschine, sind die übrigen, großen landwirtschaftlichen Maschinen Gemeinbesitz, sind von allen Ansiedlern zusammen erworben und ge-hören allen zusammen.
Hier ist Bauernwirtschaft. Ganz einfach, gar nicht kompliziert durch die Beschäftigung mit sozialen Problemen. Man muß feststellen, daß die Leute einen zufriedenen Eindruck machen. Sie haben Sorgen, frei-lich. Denn das lebendige Leben von Scholle und Tier, dieses Leben, das gepflegt und behütet werden will, um zu gedeihen, schafft jeglichen Tag Unruhe, Kum-mer, Verdruß, neben Freude und Erfolg. Diese Leute sind von Sorge tiefer bedrückt, denn es ist ihre eigene Sorge, und sie sind vom Erfolg höher gehoben, denn es ist ihr persönlicher Erfolg. Aber man muß ebenso feststellen, daß ihre geistigen Interessen nicht so rege sind, wie bei den jungen Menschen einer gemeinwirtschaftlichen Siedlung.
Gewiß, das eine hat seine Schönheit, wie das andere. Wahrscheinlich ist auch das eine so vorteilhaft, wie das andere, die Menschen, die nur an ihrem Fleckchen Erde hängen, nur an ihrer Arbeit, nur an ihren per-sönlichen Freuden wie Leiden, und die jungen Leute, die über ihr Tagwerk, über eigenen Erfolg wie Miß-erfolg hinaus, beständig an die Allgemeinheit denken und daran, wie man dieser Allgemeinheit ein Beispiel geben müsse für Fortschritt, soziales Rechtsgefühl und Selbstzucht.
Vollkommen natürlich gliedert sich das hierzulande, {208} fügt sich notwendig eines neben das andere, eins ins andere. Die Männer, die in den Siedlungen der Ebene Iezreel wohnen und überall in den Siedlungen mit Einzelwirtschaft, diese Männer stehen zwischen dreißig und fünfzig. Die Chaluzim aber, die als Taglöhner an-fangen, um dann Mitglieder einer Gemeinwirtschaft zu sein, sind zwischen achtzehn und sechsundzwanzig, sind höchstens dreißig Jahre alt. Die Männer zwischen dreißig und fünfzig haben Weib und Kind, haben ihr Eigentum. Die Jünglinge, die weder Weib, noch Kind, noch Eigentum besitzen, haben Ideale und Ideen.
Alles fließt hier, alles lebt hier noch im Anfang, alles wartet, ohne zu warten, einer Entscheidung ent-gegen, die erst in zwanzig, in fünfzig Jahren sichtbar werden kann. Die jungen Leute sagen selbst, man könne noch nichts wissen, man müsse den Dingen ihren Lauf lassen. Sie sind hier, die allermeisten, aus Revolutionären Evolutionisten geworden.
Alle zusammen aber sind sich bewußt, daß die Ar-beit das Wichtigste bleibt. Und sie arbeiten alle. Jeder an dem Platz, der ihm zugewiesen ist. Tag für Tag, von früh bis abends.
Der Mann, den ich in Balfouria besuchte, ist ein Riese. Schwer, klobig, bärenhaft in seiner Gestalt, in den Bewegungen und in seinem Wesen. Er hat eine zarte, kleine Frau, mit der er so behutsam umgeht, als ob sie aus dünnem Glas und leicht zerbrechlich wäre. Dabei beherrscht sie ihn tyrannisch, lenkt ihn mit den Augen, mit einem Zucken ihres Mundes. Eine ganze Schar von Kindern umwimmelt, umtummelt und {209} umkriecht die beiden. Das Kleinste trägt der Mann auf seinen Armen. Es ist offenbar sein anderer Tyrann. Er hat ein kleines, weißes Häuschen, aus Ziegeln ge-baut, mit Ziegeln gedeckt. Ein überdachter, loggien-ähnlicher Raum am Eingang bietet Schattenkühle und Luft. Innen zwei Wohnräume und die Küche. So ein-fach, ja so ärmlich es hier auch ist, der Mann wohnt in Wohlstand und Behagen, wenn ich des Kampierens der Chaluzim in den Leinenzelten gedenke, ihres Wohnens in den Bretterhütten. Zu dem Häuschen hier geht man doch drei, vier Stufen hinauf und seine Innenräume haben Fußböden aus Holz. Die Bretter-buden der Chaluzim jedoch sind auf die bloße Erde gesetzt. Aber was ihnen so charakteristisch ist, die Bücher, die Illustrationen an die Wand genagelt, die Musikinstrumente, diese Zeichen eines geistigen Lebens fehlen hier gänzlich.
Nur von seiner Bauernarbeit spricht dieser Mann. Und er redet nur das, was man ihn fragt. Er hegt Blumen in dem kleinen Vorgarten, hat ein paar Bienen-stöcke, zeigt seine Hühner, seine Kuh, und führt dann hinaus auf seine Äcker. Die Luft ist lind, aber frisch durchweht vom Salzhauch des Meeres. Dunkel-grün und breit steht der regelmäßige Kegel des Tabor über der Siedlung. Der Mann lächelt unbeholfen, da ich den Anblick des Berges schön nenne. Er zeigt in die Ebene, zu einem Kreis von Häusern, der ins Grün geschrieben steht und sagt: 'Nahalall."
Seitlich der Straße, die vom galiläischen Gebirge über die auslaufenden Verhügelungen niederführt, {210} zweigt in die Ebene der Weg nach Nahalall ab. Es ist eine gutgebaute, feste Fahrbahn, schnurgerade, die zu-nächst eine Eukalyptus-Schonung durchstößt, um nachher übers freie Feld bis an die Siedlung zu laufen. Die Eukalyptusbäume sind, da ich sie sehe, erst drei-jährig und schon mannshoch. Binnen wenigen Jahren werden sie so aufgeschossen sein, daß ihre Wipfel Schluß bekommen und daß sie, eine breite, ragende, grüne Mauer, den Blick von der Landstraße auf Naha-lall sperren werden.
Als sich die Ansiedler hier niederließen, gaben die Araber rings in der Nachbarschaft den Spott auf, mit dem sie sonst manchmal derartige Versuche in sump-figen Gebieten begleiten. Diesmal spotteten sie nicht und hatten keine Lust zu lachen. Der Enthusiasmus dieser jungen Leute da, ihr Feuereifer, der Mut und ihre Opferbereitschaft erfüllte die Araber mit Rührung und Mitleid. Denn diese jungen Menschen schienen alle verloren, waren sicherem Fiebertod verfallen. Ihr Verweilen und Arbeiten an so hoffnungsloser Stätte, weckte den Eindruck heroischen Massenselbstmordes. Und die Araber beklagten erschüttert den Untergang von so viel Jugend, so viel Kraft und so viel froher Gesundheit.
Aber die Schar junger jüdischer Arbeiter ging un-beirrt ans Werk. Ja, der Boden war freilich arg ver-sumpft. Der wilde Rasen stand überall unter Wasser oder das Wasser drang blasig aus der durchweichten Scholle, wo man sie berührte. Weiß Gott, wie lange die Quellen und Quellchen, die Regenrinnsale, die von {211} den Ausläufern der galiläischen Berge herunterströmen, ungenützt hier, auf dem tiefsten Punkt der Ebene zusammengesickert waren, um im Wiesengrund zu ersticken. Dem ertrunkenen Boden entstiegen die Miasmen verfaulter Vegetation. Mückenschwärme in Myriaden erhoben sich unter dem Strahl der Sonne aus dem brütenden Sumpf. Die jüdischen Siedler ar-beiteten länger als ein Jahr. Dann hatten sie weit und breit den Boden drainiert, hatten die Wasserzuläufe gefaßt, in regelmäßigen Betten genötigt, hatten für ihren Abfluß gesorgt. Dann waren sie Herren dieser Fluren in Erez Iezreel und es zeigte sich, daß es der üppigste, der fruchtbarste Ackergrund war, den das Land besitzt.
Das sieht wie ein kleines Wunder aus, wenn man hier steht, inmitten dieser reichen Siedlung. Das er-zählt sich wie ein hübsches, modernes Märchen. Schreibt sich ganz leicht, ganz mühelos hin und wirkt wie ein Lesestück, darin den Schulkindern Fleiß und Ausdauer angepriesen wird. Aber es ist durchlebt und durchlitten worden, es ist durchgekämpft, mit Hacken und Spaten, in Schweiß und Armut, in Müdigkeit und Fieber, in Siechtum und Tod. Tag um Tag, Stunde um Stunde.
Die Wassergräben, die wie Adern das Ge-filde durchziehen, reden eine ergreifende Sprache. Diese offenen Wassergräben verschwinden nach einer Strecke Weges, werden unsichtbar, gehen in unter-irdisch gelegte Röhren über. Und nun spricht der be-freite, gesund gewordene Boden von seinen Rettern. Weil draußen, fast schon an der Grenze von Nahalall {212} stehen zwei hohe Palmen in der baumlosen Ebene. Dorthin gehen wir, zwischen Feldern, auf ganz schmalen grasbewachsenen Pfaden. Unter den beiden Palmen, von Buschwerk umrauscht, entstürzt dort der Wasserreichtum dem Erdboden, entquillt in dickem Strahl der Mundöffnung, die in Beton gefaßt ist und flutet in einem Bett aus Beton, weit ins Land hinein, um noch die Äcker der Araber zu tränken. Wir kehren wieder zurück und ich habe das Gefühl, von einem Siegesdenkmal zu kommen, das nach erfolgreichem, friedlichen Kampf mit der vernachlässigten Natur er-richtet wurde. Nicht aus Ruhmsucht, überhaupt ohne jede Nebenabsicht, sondern als selbstverständliches Ergebnis. Zwei Palmen und sprudelndes Wasser.
Unter den vielen ermutigenden Eindrücken, die man in Palästina empfängt, ist es einer der stärksten, durch die Siedlung Nahalall zu wandern. Unter den vielen schönen Landschaften, die man sieht, ist diese Land-schaft eine der schönsteil. Lieblich und idyllisch. Ebene, fruchtbar, mild, von einem weiten Himmel über-wölbt, von Gebirgszügen malerisch umschränkt. Und im Nordosten der ein wenig abseits alleinstehende Tabor, in dieser Atmosphäre, die von hellem Lerchen-jubel zu klingen scheint, wie ein dröhnender Baß-Akkord.
Nach dem Plan eines modernen Architekten sind die Siedlerwohnungen hier in einem großen Kreis auf-gestellt, dessen Mitte von den Gemeinschaftsbauten, von den Schuppen für die großen Maschinen, die allen gehören, eingenommen wird. Eine breite Ringstraße {213} führt an allen Wohnhäusern vorbei. Auf den Radial-straßen gelangt man zum Gemeindeamt, zu den Maga-zinen, darin die für gemeinschaftlichen Verkauf be-stimmten Produkte aufbewahrt werden, zur Feuer-wehr, zur Klinik. Das wirkt übersichtlich und gefällig. Eine musterhafte Ordnung herrscht hier und eine blendende Sauberkeit. Die Menschen sehen gesund aus, gepflegt und zufrieden. Ich besuche zwei, drei Wirt-schaftshöfe. Überall wird mir dasselbe gezeigt und überall betrachte ich es mit dem gleichen Interesse, mit demselben Vergnügen. Kühe aus Syrien oder Hol-land, Hühnerzucht. Kleine Ententümpel, dicht am Haus. Vorgärtchen, die von Blumen flammen, Speicher, in denen Mehl, Korn und andere Lebensmittel auf-gestapelt sind.
So viele junge und lebhafte Menschen ich hier ge-sehen und gesprochen habe, auch hier fällt es mir wieder auf, daß niemand Fragen stellt. Wohin man sonst zu Juden kommt, überall wird man ausgefragt, in aller zutraulichen Freundlichkeit, aber doch voll Neugierde. Sie fragen, wo man wohnt, welchen Beruf man ausübt, ob man verheiratet ist, ob man Kinder hat, wohl auch ob man reich oder ob man fromm ist. Sie fragen nach den neuesten Ereignissen und wollen die Meinung hören, die man darüber hegt.
Aber diese Menschen hier fragen nicht. Sie sind nicht neugierig, zu erfahren, ob man verheiratet ist oder ob man Kin-der hat. Sie sind nicht interessiert an den Ereignissen in der Welt, wenigstens nicht gestimmt, gleichgültiges Geschehen zu beplaudern. Ihr Land und ihre Arbeit {214} nimmt sie ganz in Anspruch. Was gestern getan werden mußte, was heute und was morgen getan werden muß. In dieser engen Runde läuft ihr Dasein. Gesprächen über die Zukunft weichen sie aus. Manche sagen es ganz offen, daß sie an die Zukunft nicht denken, von ihr nicht reden wollen. Der Zukunft lebt am würdigsten entgegen, wer in der Gegenwart seine Pflicht erfüllt. Das sagen sie und daran halten sie sich.
Sie diskutieren gerne. Über Bücher, über alle mög-lichen Menschheitsprobleme, wenn sie junge Leute sind, oder über die Frage, ob man Wein bauen soll, Orangen, Bananen oder Tabak. Es sind Menschen der Werktätigkeit, gegenständlich, sachlich, ohne Sentiments, die in schönen Worten schwelgen, ohne Neigung zu Deklamationen. Neue Menschen.
Eine Landwirtschaftsschule für junge Mädchen ist hier in Nahalall gegründet worden. Das Haus, darin die Leiterin, eine Dame aus Norddeutschland, amtiert und wohnt, sieht reizend aus und ist innen reizend eingerichtet. Bilder in Rahmen an den Wänden, hübsche Vasen und Tischdecken ein schöner Bücher-schrank und bequeme Sitzmöbel geben Behagen. Die Leiterin hat eine gemessene, sozusagen eine päda-gogische Freundlichkeit. Ihr ganzes Wesen, alle ihre Worte sind bestimmt, ruhig entschlossen und ziel-sicher. Sie wird hier, zunächst einmal zwanzig junge Mädchen heranbilden, daß sie tüchtige Hausfrauen auf einem Bauernhof sein können. Diese jungen Mädchen werden Kühe melken und pflegen lernen, Hühner züchten, Bienenstöcke besorgen, mit allen Feldfrüchten {215} und Ackerarbeiten Bescheid wissen und sie werden verstehen, Blumengärtchen anzulegen. Wenn die Schule, die jetzt für zwanzig Zöglinge angelegt ist, sich als zu klein erweist, soll sie vergrößert werden.
Nahalall gehört zu den Kolonien, die weder Hilfe noch Zuschuß mehr brauchen, sondern sich selbst er-halten. Es ist ein Beispiel restlos und glanzvoll über-wundener Schwierigkeiten. Ein Beweis des Gelingens ist es. Die kurze Geschichte seines Bestehens gibt An-sporn und Ermutigung. Hier wurde wieder aufgebaut, was in Sumpf und Schlamm verkommen war. Hier kam wieder zum Blühen, was verfault schien.
Sei Nahalall der ganzen Aufbauarbeit ein Vorzeichen und ein Symbol.
{216}
XXIV
Auf dem Weg zur Höhe von Safed sieht man, dicht vor der Kolonie Rosch Pina, den Kanaanberg, ein steil aufragendes, mächtiges Massiv. Dieser kahle, verkarstete Berg wird jetzt wieder aufgeforstet. Der Nationalfonds hat einen Trupp Chaluzim zu dieser Arbeit beordert. Weiß man, was das heißt? Die jungen Menschen schleppen den Humus in Körben den Hang empor. Der Sonne preisgegeben und dem Wind, plagen sie sich hier in äußerster Mühsal, klettern mit schweren Lasten im Weglosen, schütten die Erde hin, festigen sie gegen Abrutsch, pflanzen Bäume, Winzigkeiten von Bäum-chen, die wachsen, die Wurzeln schlagen sollen und mit ihren Wurzeln die Erde dem Felsgestein wieder verklammern, mit ihren Wipfeln den Boden wieder schützen. Die Bäume wachsen schnell hierzulande, doch nicht alle so schnell, wie der Eukalyptus, und Eukalyptus kann man hier oben, auf Felsengrund, nicht pflanzen, weil er nasse, weiche Schollen braucht. Die jungen Leute, die sich hier darbringen, ebenso wie sie sich in Moza darbringen, im Gebirge von Judäa, und in anderen Bergkolonien, wo sie überall den Humus mit Handkörben bergan schleppen, diese jungen Leute werden die Ölbäume, die Maulbeerbäume, die {217} Mandelbäume, die Eichen und Ulmen, die sie hier setzen, nicht im Schluß der Wipfelhöhe sehen. Manche von ihnen erleben es, vielleicht, wenn sie alt sind. Viele werden schon in früheren Jahren hinsinken, denn einen Knacks holen sich die meisten, bei solch harter Robot. Aber auch diese jungen Menschen denken nicht an die Zukunft. Nur an das Land hier und an die Arbeit, die das Land ihnen abfordert. Nur an die Blößen und Wunden, unter denen der Boden hier leidet, die sie bedecken und heilen, damit neues Leben wieder möglich werde.
Knapp an der Straße nach Safed, auf einer hohen Bergkuppe, wo man schon das schneebedeckte Haupt des Hermon aus Nebelwolken schimmern sieht und der niederwärts gewendete Blick das blaue Auge des Semachontis-Sees begegnet, das aus der Tiefe empor-leuchtet, knapp an dieser herrlichen, steilen Paßstraße pflügen Kinder einen Acker. Zur anderen Seite der Straße kampieren sie, nahe dem Abhang, unter primi-tiv auf den Boden gestellten Wellblechstreifen, die aussehen, als hätte man den Rolladen eines Kauf-mannsgeschäftes herausgenommen und auf seine zwei Kanten gesetzt, so daß sich die Fläche nur von un-gefähr wölbt, oder als hätte man langgestreckte Dampfkessel der Länge nach entzwei geschnitten und beide Hälften auf den Erdboden gestülpt, damit sie Unterschlupf geben vor den Nachtstürmen.
Es sind Kinder, die da hoch oben, einsam wohnen und pflügen, säen, arbeiten - Halbwuchs. Zehn-, zwölf-, fünfzehnjährig. Doch sie haben das Furchtbarste {218} erlebt, das Menschen erleben können. Der 'sieg-reiche" Vormarsch gegenrevolutionärer Generale und ihrer Horden ist in der Ukraine, in Weißrußland und in der Gegend von Odessa über sie hinwegge-gangen. Die Welt kennt die Greuel nicht, die von den zarentreuen Soldaten, von den heldenhaften Offizieren an den Juden dort verübt wurden. Oder die Welt, von den Grausamkeiten des Krieges ermüdet, hat diese Schandtaten nicht kennen wollen. Aber von allen Schrecken, von allen Bestialitäten dieser heutigen Zeit sind das die schrecklichsten und die bestialischsten gewesen.
Es war noch das Mildeste, wenn arme Juden selbst ihr Grab schaufeln, sich lebendig hinein-legen mußten, um dann, lebendig mit Erde verschüttet zu werden. Reiche Väter, die ihr Geld versteckt hatten, lieferten es aus, gaben alles hin, damit ihre Söhne vor ihren Augen sogleich erschossen und nicht erst lange gepeinigt würden. Dann starben diese Väter, da sie nichts mehr besaßen, um für sich selbst die erlösende Kugel zu bezahlen, den langsamen Martertod.
In den verwüsteten Ortschaften wurden später diese Kinder gefunden, verwildert, verhungert und halb irr-sinnig vor Entsetzen. Noch hier in Palästina hielt der erlittene Schrecken viele von ihnen so umfangen, daß er aus ihnen hervorbrach, daß sie laut zu schreien anfingen, wenn sich ihnen jemand unerwartet näherte, auf die Knie fielen und mit gefalteten Händen bettel-ten: 'Gleich töten - nicht martern!"
Sie delirierten nur, weil das blutbespritzte Ereignis sie durchsickerte, in dem sie ihre Eltern, ihre großen {219} Geschwister qualvoll sterben sahen. Sie bettelten und baten um einen raschen Tod ... aus Erfahrung. Ein schnelles Morden war das Einzige, was sie an Güte kennengelernt hatten. Welch eine Anklage, was für eine Riesenlast von zermalmender Anklage sind diese Kinder da auf der Berghalde. Nicht bloß gegen Denikin und Wrangel, nicht bloß gegen ihre Banden. Eine vernichtende Anklage gegen die ganze Menschennatur.
Die Kinder sind heute jeglicher Gewalttat entrückt. Fern und hoch über dem Getriebe der Menschen be-bauen sie hier die Erde, sind in ihrem Gemüt schon leidlich beschwichtigt, fühlen sich zufrieden in der primitiven Armseligkeit ihres Daseins, atmen die Ruhe, den tiefen Frieden der Landschaft. Notwendige Hei-lung ihrem Gemüt und ihren Nerven. Sie wachsen heran und singen bei ihrer Arbeit. Was für eine er-schütternd beredsame Fürsprache sind diese Kinder der menschlichen Natur !
Noch ein paar Wendungen steil nach aufwärts voll-führt die Straße, dann ist man in Rosch Pina, unter-halb von Safed. Sie liegt wunderbar, diese alte Kolonie, auf dem schroffen Niedersturz eines Felsgipfels, den sie ganz bedeckt. Ein halbwegs ebener Platz ist unten, am Eingang, dann noch nach oben, wo die Häuser als Querstraße stehen, das ebene Plateau des Gipfels. Zwischen unten und oben jedoch, im Einriß des Ber-ges, die übersteile Schräge einer langen, baumbeschat-teten Straße, an der alles klettert, die Menschen, die
Häuser, die Gärten.
Vor mehr als vierzig Jahren kamen rumänische {220} Juden hierher, auf der verzweifelten Flucht vor Po-gromen. Es scheint, das Entsetzen treibt die Menschen auf Bergspitzen. Sie fingen hier Weinbau an, hatten Maulbeerbäume gepflanzt und als sich der Baron Rothschild dieser Kolonie annahm, war auch eine Seidenfabrik da. Doch sie soll schlecht verwaltet wor-den sein und mußte eingehen. Dem Tabakbau, der gut geriet, machte die türkische Regierung mit Rück-sicht auf ihr Monopol ein Ende. Von dem ausge-dehnten Grundbesitz der Kolonie, weitaus dem größten, der irgendeiner Siedlung gehört, ist nur ein Drittel fruchtbar. Zwei Drittel sind Felsen, auf denen bloß Ziegen weiden. Dennoch haben sich Menschen da ihre Unabhängigkeit erarbeitet. Einige von ihnen sind sogar wohlhabend. Äcker und Weingärten, Mandel- und Olivenbäume bringen ihnen gute Ernte. Ihr Leben geht ruhig dahin und friedlich, seit Dezennien. Gab es Drangsalierungen der türkischen Herrschaft oder Feindseligkeiten der Araber, so war das doch Sanftheit, war nichts im Vergleich mit den Pogromen in Rumänien.
Ich klimme die Bergstraße empor. Entzückende Häuser zu beiden Seiten, eingesponnen in üppig pran-gende Gärten. Prachtvolle alte Bäume ragen aus der grünen Wildnis dieser Gärten. Oben auf dem Gipfel, zur Linken, der schloßartige Eingang zu einem Park, darin, stockhoch ein Gebäude, das herrschaftlich an-mutet. Dann eine Straße, die um die Ecke biegt und eben verläuft. Kleinstädtisch, Haus bei Haus, kein Garten, kein Baum mehr.
{221} Wir wollen in die Synagoge, doch der Synagogen-diener, der den Schlüssel verwahrt, muß erst geholt werden. Indessen schaue ich mich um, betrachte die kleinen Kaufläden und den wunderlichen Kram, den sie feilhalten, bewundere ein schönes Reitpferd, einen Eisenschimmel, das frei dasteht, seines Herrn wartet und mit dem einen Vorderhuf den Kiesboden schlägt, daß die Funken spritzen. Ich betrachte die Leute, die sich angesammelt haben und mich betrachten. In diesem Augenblick bin ich es müde, immer wieder fremde Menschen anzusprechen und warte lieber, bis ich angeredet werde. Aber niemand sagt ein Wort zu mir. Endlich kam der Mann, der das Gotteshaus aufschließen sollte. Lieber Himmel, er war sehenswür-diger als die kleine Synagoge, die sich nett und würdig repräsentierte, ohne einen ungewöhnlichen Anblick zu bieten.
Dieser Greis aber, in hellem orientalischen Kaftan von verwaschener Farbe, mit einer turban-ähnlichen rot und gelb gestreiften Kopfbedeckung, dieses schwächliche, zarte Männchen sah verblüffend aus; grotesk und ehrwürdig, unwiderstehlich komisch und dennoch: das verwitterte, beinahe schon wieder zu Erde gewordene Antlitz, das der weiße Bart wie wirres Gestrüpp umstarrte, dieses Antlitz und die großen dunklen Augen, so ganz erfüllt von Tragik, daß man davon ergriffen ist. Den Versuch, ihn zu photographieren, hindert der alte Mann, indem er der Kamera jedesmal kunstvoll ausweicht, als habe er sie gar nicht bemerkt. Er grüßt nicht, er spricht nicht, er dankt nicht für die Gabe, die seine Bemühung lohnt.
{222} Er ist uralt und scheint schon jenseits aller Beziehung zu Menschen. Die anderen respektieren ihn mit einer deutlichen Beimischung von Furcht. Richtet man eine Frage an ihn, dann trifft sein Blick gebieterisch einen der Umstehenden und dieser antwortet.
In der Straße, die von der Synagoge weg das Gipfel-plateau entlang führt, das Kleinleben der Krämer- und Handwerkerfamilien, die vor den Türen sitzen und im Freien alles haben; Kinderstube, Küche, Werk-statt. Dicht an Rosch Pina das Araberdorf Dscha'une. Denn diese Siedler der alten Zeit beschäftigen immer noch arabische Arbeiter, was ja die neue Aufbaubewegung natürlich unterlassen muß. Die Araberkinder von Dscha'une besuchen alle die Schule, die ihnen durch die Kolonie erbaut wurde und wo sie hebräisch unterrichtet werden.
Niedersteigend zum unteren Platz, bleibt man sich unaufhörlich bewußt, auf einer hohen, steilen Berg-spitze zu sein. Der Boden weicht jäh unter den Schritten. Man muß achtgeben, nicht zu stürzen. Es ist, als steige man in einem Abgrund eine steingepfla-sterte Rinne herunter, zu beiden Seiten herrlich umgrünt. Hebt man den Blick geradeaus, so fliegt er ins weite Land. Man sieht den Hang des Berges nicht, auf dessen Gipfel man wandelt, sieht nur den weißen Bodenstreifen vor sich, der ins Nichts zu stürzen scheint, und drüber weg, tief unten die Jordanebene, dann das nördliche Ende des Tiberiassees, ein blauer in Berg und Hügel gebetteter Wasserspiegel.
Unten gesellt sich ein alter Mann zu mir. Er war {223} einer von denen, die auf der Flucht vor den Pogromen aus Rumänien hierhergekommen sind und Rosch Pina gegründet haben. Seither hat er diesen Felsgipfel nicht mehr verlassen. Die harten Zeiten, die hier durch-gekämpft werden mußten, sind nun überstanden. Der alte Mann hat jetzt verheiratete Kinder, erwachsene Enkel; er ist wohlhabend und seine ganze Familie ist hier geblieben, in Rosch Pina.
{224}
XXV
Kurz, steil und großartig ist die Auffahrt nach Safed. Auf breitem Bergrücken dehnt sich die Straße, eine weiße Leine, straff und gerade durch das grüne Fell des Bodens gezogen. Dann läuft sie, jenseits einer noch unsichtbaren Sattelsenkung in schnellen Serpentinen einen Felsen hinauf. Man sieht sie, hoch über sich und glaubt nicht daran, daß man dorthin gelangen wird. Eine Viertelstunde später blickt man von der obersten Serpentine auf Sattelsenkung und Rücken-breite zurück und bewundert das einfache Märchen der Bergwege. Wir sind beständig am Rand des galiläischen Gebirges, haben immer wieder zur Rechten den herrlichen Blick in die Weite der Ebene, zu den blauen Augen der beiden Seen, die abwechselnd aus der Tiefe aufblitzen.
Endlich breitet sich das Amphitheater der Stadt vor uns. Sie scheint so hoch zu liegen, wie der Berg, dessen Gipfel wir selbst jetzt überfahren. Wir gleiten in den geräumigen Einschnitt, der muldenartig Gipfel von Gipfel trennt. Nun ragt die Stadt hoch über uns und wir müssen zu ihr emporklettern. Eine weiße, von Höhenluft durchatmete Stadt. Ihre Straßen rennen in engen Kehren übereinander, derart, daß auf der einen {225} Seite die Häuser aufragen, und daß man zur anderen Seite wieder mit den Füßen die Dächer der Häuser berührt, die auf der nächst unteren Kehre stehen. Doch Treppensteige verbinden Kehre mit Kehre. In Prag gibt es auf dem Hradschin ein paar solche Szenerien. Man tritt in ein Haustor, steigt vier Stockwerke hinauf, geht oben einen Korridor entlang, öffnet eine Türe und ist wieder auf der Straße. Freund Kvapil, der große tschechische Dramaturg und Regisseur, hat sie mir einmal gezeigt und ich bin seither oft wieder hin-gegangen. Hier in Safed sind alle Häuser so an die Berglehne gestellt. Man könnte in jedes zum Tor hin-ein, die zwei Stockwerke hinauf und durchs Dach wieder auf die Straße gelangen.
Safed hat das entschlossen trotzige Aussehen aller Städte, die an hohe Berggipfel geklammert sind. Ent-weder der Angriffslust verdanken solche Städte ihr Entstehen und sind Raubnester gewesen, wie Jeru-salem, bevor König David es eroberte, oder sie waren Zuflucht von Gejagten, die sich so hoch und einsam an-siedelten, um vor Verfolgungen Ruhe zu haben wie Rosch Pina. Oder, sie gingen, wie Safed, aus Befesti-gungen hervor. Hier hat sie Josephus errichtet, das Land gegen erwarteten Einfall zu verteidigen.
Wie ein kleiner Saal wirkt der Basar. Mit der farbentrunkenen Buntheit der offenen Läden wie ein festlich geschmückter Saal. Die Araber sitzen hier vor ihren Kaufläden, sitzen auf dem Brett, das als Ver-kaufspult dient, sitzen vor dem kleinen Cafe auf der Straße, trinken Mokka, essen Süßigkeiten, rauchen {226} Nargileh, Tschibuk und Zigaretten, spielen Domino und Schach oder schauen still vor sich hin, oder lauschen einem Grammophon oder verhandeln ein Geschäft. Und feiern in allem das Fest des Lebens. Es ist ihre Weisheit, ihr gelassenes Daseinstempo, ihre Anmut, daß sie alles so tun, als feierten sie das Fest des Lebens. Es ist ihr Alltagszustand.
In einer Bude, an der ich vorbeikomme, sitzt der In-haber, das Ohr dicht an den Schalltrichter eines Grammophons geneigt, dem eine Blechmusik turbulent entschmettert. Er lächelt beglückt, mit geschlossenen Augen. Da ich stehen bleibe, blinzelt er mich an und nickt mir freundlich zu. Die Platte ist abgeschnurrt. 'Warte," ruft er eifrig, 'ich bitte dich, warte ... noch einmal von Anfang. Du hast den Anfang nicht gehört. Es ist die türkische Hymne. Warte doch! Die Hymne von Abd ul Hamid!" Er hatte in hastiger Eile die Nadel gewechselt, die Kurbel gedreht und die Hymne erklingt wieder, etwas dünn, ein wenig heiser krähend, die Tschinellen, die Paukenschläge, die Zymbeln, Bom-bardons und Trompeten, leise von dem Geräusch durchkocht, das die Nadel auf dem Hartgummi ver-ursacht.
Den Zappelrhythmus und die Melodie er-kenne ich nach und nach. Ich hörte sie zuletzt beim Selamlik vor dem Yildiz Kiosk zu Konstantinopel. Der Mann leuchtet mich an mit seinen großen, dunkeln Augen und mit den weißen Zähnen, die aus dem schwarzen Bart hervorblitzen: 'Herrlich! Was? Fabelhaft! Nicht wahr?" Ich stimme natürlich in seine Bewunderung mit ein. Er wird ganz taumelig vor {227} Seligkeit. 'Warte! Ich beschwöre dich! Bei deiner Mutter beschwöre ich dich", sagt er dringend, sanft, flehentlich. 'Noch einmall Ja? Was hast du zu ver-säumen? Du kommst überall hin noch zurecht! Was kannst du Schöneres hören? Warte, ich bitte dich!"
Und ich wartete. Ich hörte die Hymne noch einmal. Als sie zu Ende ist, hat er gute Lust, sie mir ein drittesmal vorzuspielen. Ich sehe ihm das an und merke, daß er es nur nicht wagt. Ich frage ihn, ziem-lich gedankenlos, ob die Zeiten Abd ul Hamids schöner waren, und ob er sich nach der Regierung der osmanischen Sultane zurücksehne. Aber ich bereue diese Frage schon, während ich rede. Denn er könnte mir mißtrauen und mich für einen Agent provocateur halten. Richtig, sein bestürztes Gesicht ist ganz Bitte um Entschuldigung. 'Nein, um Gottes willen, nein!" Wie ich nur so was von ihm denken könne. Dann voll Zärtlichkeit: 'Aber diese Musik hat solch einen Zauber. .." Jetzt ersuchte ich ihn, die Hymne noch einmal abrollen zu lassen und er ist vollständig be-ruhigt, wird bei ihren Klängen wieder schwelgerisch glücklich.
Ich kann ihn so gut verstehen. Es gibt auch in Österreich Menschen genug, die der Monarchie nicht nachtrauern, den Sturz der Habsburger nicht beklagen, aber doch bewegt werden, wenn sie die schöne, alte Melodie von Haydn hören, die ihnen lieb ist. Und ich gehöre zu diesen Menschen. Wir schütteln uns herzlich die Hände, der arabische Kaufmann und ich, zum Abschied. Er hat mir Kaffee angeboten und Zigaretten, aber nicht den leisesten Versuch gemacht, {228} mir von seinen Perlschnüren, Reitstöcken oder Teppichen etwas zum Kaufe vorzuschlagen.
Behaglich sitze ich mit Chaim Mandelbaum bei Tisch. Es ist ein steinernes, stockhohes Haus, in das man durch einen Gartenhof gelangt. Ein offener, von einem Mauerbogen überwölbter Raum trennt Küche vom Gastzimmer. Wir halten uns, bis das Essen bereit ist, da auf. Schattig ist es da, man fühlt die Sonnen-hitze und hat einen kühlenden Hauch um sich. Ich genieße den freien Blick, der sich von hier ins Berg-land öffnet, und plaudere mit den beiden jungen Mädchen, die für uns kochen. Das Haus hier ist Frem-denherberge und Waisenanstalt zugleich. Elternlose Mädchen werden da erzogen, und lernen kochen, lernen häusliche Arbeiten. Die beiden jungen Dinger da, fünfzehn- und sechzehnjährig, sind stramm, stark wie Bäume, tüchtig, flink und ganz kindlich. Binnen zwanzig Minuten dampft die Mahlzeit auf dem Tisch. Die beiden barfüßigen Mädel stehen dabei, wischen sich die erhitzten Gesichter, lachen und freuen sich, weil es uns schmeckt.
Dann bin ich in der kleinen Synagoge, die vier-hundert Jahre alt ist, bin unter würdigen alten Män-nern, die da beständig beten und studieren, mit Freundlichkeit aufgenommen. Die Sparren, die das Ge-wölbe stützen, das Holzwerk der Bänke, die Leuchter aus Messing, der gestickte Vorhang, der den Thoraschrein deckt, alles ist alt und ehrwürdig. Von jeher ist Safed berühmt gewesen als eine Hochstätte jüdischer Gelehrsamkeit. Berühmte jüdische Denker wirkten hier, {229} wo es viele Talmudschulen gab. Hier wurde, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts die erste Buch-druckerei des Orients errichtet. Aus allen Ländern der Welt zogen Studierende und Lehrer hierher, die Ge-meinde wuchs, und es blühte Wohlstand in ihr, es blühte der jüdische Geist und die jüdische Mystik der Kabbala. Kriegsstürme, Erdbeben und Seuchen haben das Volk hier oftmals gänzlich vernichtet. Heute leben neben neuntausend Arabern sechstausend Juden da.
Warum mein Herz dieser Stadt und ihren Menschen, Juden wie Arabern, so rasch und so innig verknüpft ist, warum ich mich hier so merkwürdig heimisch fühle und zu Hause, so wehmütig angeheimelt, wie ein halbwüchsiger Junge in Großvaters Stube, vermag ich eigentlich in Worten nicht so recht zu sagen. Es gibt ein Empfinden, ein Ahnen, das keine Worte kennt, nur Töne. Und in mir wacht ein Klingen auf, nun da ich Safed verlasse, eine undeutliche Melodie, getragen und feierlich; auf dunkeln, melancholischen Unterstimmen gewiegt, ein heller Gesang. Er kommt aus meiner Seele, aus ihrer Tiefe, in der sie keine Sprache hat. Er ist von dieser Stadt in meine Seele gedrungen aus erlauschten Vergangenheiten, mit denen ein Etwas in meinem Blut und Wesen zusammenhängt.
Lebwohl, Safed, du stolze Bettlerin! Auf dem hohen Thron deines Berggipfels ist es dir immer noch anzu-merken, daß du einst Heldin warst im Kampf der Völker, daß du lange Herrscherin gewesen bist im Reich des Geistes.
{230}
XXVI
Sacht gleitet der Weg die Hügel nieder: nach Tiberias.
Wir kommen aus Jerusalem, auf der Straße, die durch Nablus führt, sind dann über Nazareth und Kana gefahren. In Nablus haben wir Station gemacht. In Nazareth sind wir zur Nacht geblieben.
Uralt ist Nablus, das in Bibelzeiten Schechem hieß und Sichem. Hier war Josua mit allem Volk. Hierher kam der Sohn Salomos, Rehabeam, nach dem Tod des Königs und ganz Israel ging nach Schechem, 'ihm zu huldigen". Einige glauben, hier im Lande Ephraim sei der Felsen auf dem Abraham seinen Knaben Isaak opfern wollte. Hier wandelt man auf Jakobs Spuren und ganz nahe dem Jakobsbrunnen wird das Grab Josefs gezeigt.
Am Fuß des Berges Gerizim liegt Nablus, in einem lachenden, blühenden Tal der Hügel von Samaria. Heute wohnt kein einziger Jude mehr in Nablus. Nur siebenhundert Christen leben da, und das winzige Restchen von Samaritanern, etwa hundertfünfzig oder hundertsiebzig Menschen unter dreißigtausend moslimitischen Arabern, die fanatisch sind und angriffs-lustig, die keinen Fremden in ihrer Mitte dulden. Man {231} wird vor Überfällen gewarnt und erhält den Rat, sich Bedeckungsmannschaft mitgeben zu lassen. Ein tschechischer Tourist wurde zwei Tage, nachdem ich in Nablus war, ermordet und beraubt, seine Frau schwer verwundet. Chaim Mandelbaum und ich sind allein. Die Leute zeigen sich weder feindselig noch gast-lich. Ihr Wesen ist so fremd, so starr gleichgültig, so gelassen abweisend, wie ich es nur in Tanta, am Nildelta, vor zwanzig Jahren gefunden habe. Dennoch, man geht hier in einem glückseligen Gefilde umher. Üppig grünen die Gärten, üppig gedeiht die Ernte auf den Feldern. Und die Arbeit in der Stadt floriert. Sie machen hier Seife, die in alle Welt verschickt und zu den kostbarsten Parfümerieseifen verarbeitet wird. Sie haben herrliche türkische Bäder. Denn es gibt Wasser genug. Vom Berge Gerizim springen die Quel-len, in allen Straßen der Stadt hört man die Bäche murmeln.
Ein Korso von Frauen und Kindern ergießt sich über die Friedhöfe. Vornehm gekleidet die meisten Frauen und Kinder. Sie gehen hier zweimal die Woche zu ihren Toten. Ein schöner, doch ein melan-cholischer Brauch, in dem sich der düstere Sinn dieses Volkes ausspricht. Sie hätten hier liebliche Prome-naden in der Umgebung der Stadt. Unter schönen Bäumen, zwischen Wiesen und Hecken, am Gestade der murmelnden Gewässer. Aber sie gehen zu ihren Toten, Hinaus auf die Friedhöfe, auf denen keine Pflanze wächst, keine Blume blüht. Sie wandeln, vor-nehm gekleidet und traurig unter den Steinen.
{232} Bei Tisch gesellt sich ein Samaritaner zu mir. Ein schmaler, feingliedriger Mann, der adelig und über-züchtet aussieht. Er hat sehr viel Würde und dennoch ungeheuer viel Erbötigkeit. Daß ich ihn mit gastlicher Höflichkeit behandle und ihn ein wenig bewirte, freut ihn sichtlich. Er spricht davon, daß die Samaritaner die einzig echten Juden sind, daß sie die einzig wahre Thora besitzen, daß sie noch wie in Bibelzeiten, auf Bergeshöhe opfern und er lädt mich ein, ihre Synagoge zu besuchen.
Ehe wir dann nach Nazareth kommen, bugsiert Chaim Mandelbaum das Auto den halsbrecherischen Weg nach Schomron (Samaria) hinauf, das jetzt Sebastije heißt. Pracht und ausschweifende Sünde war das Leben in Schomron. Einen elfenbeinernen Palast hat Ahabs Frau hier errichtet. Eine Kolonnade umgürtete den Bergkegel, fast zwei Kilometer lang. Nichts mehr von all dem Prunk ist übrig. Ein elendes Araber-dorf klebt auf dem Gipfel. Verstreute Trümmer liegen umher, Säulen, mächtige Monolithe, von Gräsern überwuchert. Der Letzte, der hier Monumentalbauten erstehen ließ, war Herodes. Da stecken noch die ge-waltigen Fundamente des Augustus-Tempels im Boden, da liegen noch kunstvoll geschmückte Kapitale umher, unnütz geworden und herrenlos. Während des Titus-krieges ließen die Juden diese Luxusstadt in Flammen aufgehen. Der Araber, der sich bei den Ruinen zu uns findet, tanzt und lacht.
Wir fahren weiter. An Emek vorbei. Vorüber am Randstreifen der Ebene Iezreel, am herrlich ragenden {233} Berg Tabor vorbei, die Höhen von Südgaliläa hinauf, und da, liegt Nazareth vor uns, breit hingefächert auf breitem Hang. Wird Nablus nur von Moslims bewohnt, so leben in Nazareth fast ausschließlich Christen. Erst zweihundert Jahre ist es her, daß die kleine Ortschaft wieder zum Städtchen anwuchs. Franziskaner waren damals die ersten, die seit der Vernichtung der Kreuz-fahrer sich wieder ansiedelten, andere Mönche und Nonnen folgten. Kloster neben Kloster steht hier und die Frauen lernen bei den Schwestern Spitzen häkeln oder klöppeln. Von den Erinnerungsstätten an Jesus weiß nur die Überlieferung. Ein Brunnen der auf freiem Platz rauscht, wird der Brunnen Mariae ge-nannt.
Unweit davon wird der Platz gezeigt, wo die Zimmermannswerkstatt des Josef gewesen ist. Man sieht in den Straßen außer den Mönchen und Nonnen, außer den Kameltreibern und Arbeitern, englisches Militär. Die Engländer führen hier, wie überall ihre englische Lebensweise. Sie spielen Golf, Polo und Tennis. Die Mannschaft spielt Fußball. Im Hotel, wo einige höhere Offiziere wohnen, sieht man in ihre Zimmer. Man kann gar nicht anders, als hineinsehen, denn die Türen stehen sperrangelweit offen. Der Herr Major oder der Herr Oberst liegt im Streckfauteuil, raucht die kurze Pfeife und guckt in die Zeitung, indessen Mylady auf dem Kanapee sitzt und ein Buch liest. Es ist täglich nach dem Fünfuhrtee das gleiche Bild. Abends er-scheinen sie in Toilette zum Dinner, schweigsam und manierlich.
{234} Eines Abends an der Table d'hote kommt ein Hund, ein großer Stallpintscher, zu mir und legt sein schönes, zerrauftes Philosophenhaupt ganz leise auf mein Knie. Erfreut reiche ich ihm ein paar Bissen, die er ganz ruhig, ohne Hast noch Gier, mit der Vornehmheit, edler Rassen annimmt. Die Intimität, ihn zu streicheln, erlaube ich mir nicht. Da wendet sich überm Tisch ein alter, langer Amerikaner an mich und fordert mich auf, seinen Hund nicht zu füttern. Er spricht ziemlich unwirsch, beinahe zornig. Ich gebe ihm den Rat, sich an seinen Hund zu halten. Das Zutrauen des Pintschers, der seinen Kopf auf mein Knie legt und der überhaupt viel artiger zu sein scheint als sein Herr, kann ich nicht anders erwidern, als indem ich ihn füttere. Das glatte Gesicht des alten Amerikaners ver-wandelt sich. Er wird ganz freundlich, er lächelt sogar und fragt: 'Lieben Sie Hunde?" Mir liegt nichts an einem Gespräch, ich nicke nur, lese in dem Buch, das neben dem Teller vor mir liegt, weiter und fahre fort, ab und zu einen Bissen dem Hund zu reichen, der bei mir verharrt und nicht abgerufen wird.
Schön ist der Morgen in Nazareth. Man sieht fast überall, beinahe von jeder Straße aus den größten Teil der Stadt. Sie liegt ganz offen, hingebreitet auf der sanften Schräge des Bergrückens, weit auseinander-gerückt die Häuser, die großen Klosterbauten, dazwi-schen ausgedehnte Gärten. Diese Szenerie atmet Milde und Sanftheit. Auf diesem Schauplatz vergehen die Jugendtage Jesu. Hier lebt er mit Josef, dem beschei-denen, ehrlichen Zimmermann, mit Maria, seiner {235} Mutter. Hier spielt die Idylle, der dann die Tragödie folgt. Viele Autos rattern durch Nazareth. Etliche von ihnen brachten heute eine ganze Schar amerikanischer Pilger, die abends bei Tisch den kleinen Speisesaal mit Lärm und Gelächter erfüllen. Sie sind früh nur eine Stunde etwa in Nazareth gewesen, kommen vor dem Dinner schon aus Tiberias zurück und werden sich vielleicht morgen schon in Haifa oder Jaffa einschiffen, oder per Bahn nach Alexandrien reisen. Diese Leute 'machen" Palästina in fünf, sechs Tagen ab. Sehr viele Araber haben Autos oder mieten sich welche. Sie sind wie närrisch mit diesem Vehikel. Immerfort trifft man auf den Straßen nach Tiberias Automobile, ge-drängt voll mit Beys und Scheichs und Derwischen, die nach Transjordanien fahren oder von dorther kommen.
Bald hinter Nazareth in einem großen, grünen Kessel liegt Kafr Kanna, das Kana des Neuen Testaments. Man nähert sich auf diesen Straßen, die überall in den entwaldeten Bergen hier dramatisch genannt werden können, jeder historischen Stätte in Erregung. Der Ort, den man zum Ziel hat, oder den man durchfährt, wird von weitem schon sichtbar, verschwindet wieder, wo-durch das gespannte Erwarten gesteigert wird, taucht wieder auf, wenn der Weg sich wendet und liegt dann überraschend vor dir, was immer eine starke Wirkung übt. Dann ist man in der Ortschaft, ehe man sich's versieht, ist wie gebannt von ihr, und löst sich wieder, unmerklich. So fahren wir durch Kanas Gärten, darin {236} heute wenig mehr als eine stattliche Klostersiedlung zu sehen ist, auf deren Gebiet Beduinen weiden dür-fen. Wir sehen im Weiterfahren die jüdische Musterfarm Sedschera in der Tiefe des Tales.
Dann kam das Schauspiel der Niederfahrt zum See Genezareth. Er hat im Laufe vieler Jahrtausende mehrere Namen erhalten. Er hieß Ginosarsee im Alten Testament, Genezarethsee im Neuen, und er wird jetzt Tiberiassee genannt oder Tibarija, nach der Stadt, die nahe den heißen Heilquellen Herodes Antipas an seinem Gestade erbaut und der er den Namen des Kaisers Tiberius verliehen hat. Alte, ehrwürdige Er-innerungen birgt Tiberias den Juden. Hierher kam nach der Zerstörung Jerusalems das Synhedrion, Tibe-rias wurde das Zentrum des jüdischen Geisteslebens jener dunkeln Zeit. Die Mischna gelangte in Tiberias zum Abschluß und der jerusalemitische Talmud. Jetzt aber denken wir nicht der Vergangenheit. Ganz Auge ist man, ganz atmendes, schauendes Entzücken.
Der See gleicht einem der schönsten Seen im Salz-kammergut oder in den Alpen. Man stelle sich den Wolfgang- oder den Attersee im Klima und in der Vegetation von Indien vor. Denn wir sind hier zwei-hundert Meter unter dem Meeresspiegel und demnach in den Tropen.
Gärten, hochansteigende Berge an den Ufern und die breite, smaragdene Fläche des Sees. Geruch von Süß-wasser, von Orangenblüten, von Bananen und Palmen, von starken Gewürzen in der Luft. Sonne, blauer Himmel und eine üppige, eine zärtliche, eine verzärtelte {237} Landschaft. Heiterkeit, Gedeihen, sorgloses Dasein wohin man blickt. Doch die helle Melodie dieser Natur ist untermalt von dem ehern ernsten Ton, den die Hitze beifügt. In dem brennenden Antlitz dieser Gegend steht himmlisches Leben, märchenhaftes Reifen allem Gesunden, aber allem, was nur angeritzt ist von Krankheit, ein rascher Tod. Das ist wie überall in den Tropen. Davon wird das Gefühl der Gegenwart bis zur Trunkenheit erhöht. Ich bin wie in einem Rausch, je näher ich komme, je tiefer die Straße fällt.
Die Straßen von Tiberias, das ganz in sich massiert am Ufer liegt, durchstreife ich stundenlang, bin stun-denlang in den Bazaren, tauche in das Lärmen und Treiben, in das Getümmel und Gedränge hundert-fältiger bunter Gestalten, wie in ein Bad, darin man Erfrischtheit genießt und das Zuströmen neuer Kräfte. Immer wieder stoße ich durch Gassen und Gäßchen, durch Torbögen und Zugänge auf das Seeufer, erblicke immer wieder den festlichen, blau oder grün schim-mernden Wasserspiegel hereinleuchten in den Häuser-schatten der Stadt. Stundenlang verweile ich auf der Dampferbrücke oder auf dem Vorplatz des Cafes, das dicht dabei liegt. Schaue den Arabern zu, die hier Domino spielen und rauchen. Oder schaue das Gestade auf und nieder und genieße die malerisch bezaubern-den Bilder, die ein Segelboot bietet, das fahrtbereit im bespülten Sand liegt, oder Rinderherden, die still bis an den Leib im Seichtwasser stehen, oder badende Knaben, deren nasse, braune Körper in der Sonne {238} glänzen.
Ich sitze stundenlang auf der Hotelterrasse und bewundere die Stadt, die ganz dicht vor mir liegt, nur durch die Breite der seewärts laufenden Fahr-straße getrennt, und die trotz solcher Nähe ganz zu überschauen ist. Sie hat mit ihren flachen Dächern, mit ihrem Minaret, mit ihren Kuppeln eine prächtig beredsame, eine charakteristische Silhouette von höchstem exotischen Reiz. Und sie gibt mit dem See, mit den grünblauen Bergen, die jenseits ihrer Mauern den Hintergrund schließen, einen seligen Zusammenklang. Abends, als wolle das Schicksal es verhüten, daß wäh-rend meines Aufenthalts die Schönheit dieses Erden-tals in Finsternis sinke, kommt auch noch der Voll-mond und hebt die Stadt, den See und die Berge in den Silberglanz seines Lichtes, wandelt die ohnehin be-törende Wirklichkeit des Tages in verwirrend holden Märchenzauber.
Auf den Höhen über Tiberias liegen berühmte Ge-lehrte, berühmte Rabbis begraben. Maimonides ruht hier und Rabbi Akiba neben manchen anderen, und ihre Schlummerstätten sind das Ziel der jüdischen Pilger.
Unten, am Seeufer jedoch, eine kurze Strecke außer-halb der Stadt, springen die heißen Mineralquellen. Ungenützt und ungefaßt, rinnen etwa vier Quellen über die Straße, die am Gestade entlang führt, in den See. Die kleinen Dampfwolken, die nahe am Boden dem rauchenden Wasser der Quellen entschweben, machen sie kenntlich. Nur die fünfte Quelle wird zu Heilbädern in ein Haus von abenteuerlicher Primitivität {239} und Schmutzigkeit geleitet. Vierundzwanzig Stunden lang muß das Wasser, das in einer Wärme von zweiundsechzig Grad aus dem Berg strömt, in einem Be-hälter verkühlen, ehe es zur Benützung tauglich wird. Diese arabische Badeanstalt, mit ihren gemauerten, lichtlosen Kabinen, mit ihren Holzpritschen, mit dem ge-meinsamen Baderaum, in den ich durch Zufall blickte und einen wahren Hexensabbath von nackten Weibern sah, diese engen, glitschigen Treppen - kein zivili-sierter Mensch möchte sich hier entkleiden. Aber die Heilkraft der Quelle ist so enorm, daß jetzt hundert-tausend Karten im Jahr verkauft werden. Von weit und breit kommen Kranke hierher, tauchen in dieses Wasser und genesen von ihren Leiden. Schon im Alter-tum sind diese Thermen berühmt gewesen. Welch ein Reichtum könnten sie für die Stadt, für das ganze Land werden, wenn hier ein richtiges modernes Kur-haus errichtet würde, wenn sachkundige Ärzte da wären, die Bäder und deren Dauer zu dosieren und zu beaufsichtigen. Hotels müßten am Seeufer erstehen, eines neben dem andern, eine Riviera von Pracht-bauten und Tiberias würde üppiger gedeihen, Migdal höher erblühen.
Auf der den heißen Quellen entgegengesetzten Seite von Tiberias, an der Stelle, an der einst jenes Magdala stand, das der Büßerin den Namen Magdalena gab, liegt die Farm: Migdal. Wohlhabende russische Juden haben sie gegründet, vor etwa fünfzehn Jahren und jüdische Arbeiter bebauen sie unter der Führung eines Verwalters. Auf den Hügeln, an der Straße nach {240} Nazareth, stehen Wohnhäuser. Da sind Grundstücke für Villen parzelliert, Äcker sind da und Gemüsegärten. Unten, am Seeufer, auf dem flachen Boden jedoch be-findet sich die Baumpflanzung und hier tritt man in ein Paradies.
Dattel- und Kokospalmen gibt es hier, in deren Schatten man wandelt. Früchteprangende Orangenhaine, Zitronensträucher, Bananenplantagen, die ihren feuchten, bittersüßen Duft verhauchen. Bambusdickicht und schwellende Ananasbeete. Köst-liche Stunden haben wir da verträumt, denn hier, in der von Leben schwangeren und vom Tod durch-tränkten Atmosphäre der Tropen, in der Fülle und Vielgestalt der Bäume, der prangenden Zweige, der üppigen Blätter, der exotischen Formen von Frucht und Blüte, hier, wo die Sinne von all dem Duft be-täubt werden, stellen sich wieder Träume ein.
Dieser beglückte Boden ist der Gegenwart des Landes voraus, enthüllt ein Stück Zukunft, so wie sie werden kann, wie sie werden muß, wenn der Aufbau Palästinas ge-lingt.
{241}
XXVII
Am Südende des Sees, dort, wo ihm der Jordan wieder entstürzt, ist Kolonie und Farm Kinnereth. Ruinen einer alten Stadt finden sich in der Nähe, hügelaufwärts. In noch älteren Zeiten, als das Volk unter Josuah ins Land kam, es eroberte und unter sich verteilte, hat es hier eine Stadt gegeben, die Kinnereth hieß. Vielleicht liegt die Kolonie, die sich nach ihr nennt, an derselben Stelle. Eine lange Zufahrt zwischen Kolonistenhäuschen, die in kleinen Vorgärten stehen. Zur linken Hand, am Beginn dieser Zufahrt eine stattliche Villa, deren Obstgärten, Gemüsebeete und Äcker, sich abwärts, dem See entgegenbreiten. Wir lassen den schönen Herrensitz einstweilen liegen, und gehen zu den Bauern. Die älteren betreiben Eigenwirt-schaft. Später erst angegliedert wurde eine Vereinigung junger Siedler, die in Gemeinwirtschaft leben.
Der Bauer, den ich besuche, führt mich überall um-her. Wir gehen über die hügeligen Felder, von denen man zu den Bergen aufblickt und zum See nieder-schaut, der groß und sonnenbeglänzt spiegelt. Die Felder sind sorgsam bebaut. Getreide aller Art gedeiht vorzüglich. Obstbäume dazwischen tragen reiche Frucht. Wir wandern auf einem Fußsteig eine lange {242} Mauer hin. Es ist die Rückseite der ganzen Reihe von Bauernhäusern, da, wo sie ihre Ställe haben, ihren Geflügelhof und ihre Geräte. Und es ist eine starke Mauer, die zum Schutz gegen Überfälle errichtet wurde.
Wir kommen in das Haus des Bauern, der mich geleitet und ich bin wieder erstaunt, bin wieder gerührt, denn die Ärmlichkeit, die da herrscht, hat etwas Er-greifendes. Der Mann zeigt mir seine Hühner, seine Kuh, seine paar Enten und Gänse. In seinen Stuben gibt es nichts zu zeigen. Da sind die primitiven Betten, die bei uns jedem Proletarier zu schlecht wären. Da sind Tisch und Stühle aus rohem Holz gefügt und da ist ärmliches Blechgeschirr. Dieser Mann wirtschaftet fünfzehn Jahre in Kinnereth. Er sieht abgeplagt und früh gealtert aus, auch seine Frau trägt die Spuren schwerer Arbeit und vorzeitigen Welkens. Sie haben nichts erübrigt, bringen nichts vor sich als das nackte Leben. Wie ist das nur möglich? Er zuckt die Achseln. 'Ich muß hier immer wieder an meinem Schaden klug werden. Jawohl, man wird vielleicht klug, aber man bleibt arm.
Als ich anfing, Weizen zu bauen, mußte ich lernen, wie Weizen gebaut wird, wie man pflügt, um ihn zu säen, und alles übrige. Das kostete den Ertrag einiger Jahre. Nun soll ich Tabak pflanzen. Es wird ja überall im Land viel Tabak gepflanzt, und man glaubt, der Tabakbau habe die besten Aussichten. Man sagt uns: pflanzt Tabak! Aber man sagt uns sonst nichts. Ich werde nun Tabak bauen und so lange Schaden haben, bis ich aus eigener Praxis gelernt {243} habe, etwas davon zu verstehen." Er seufzt. 'Man müßte Leute schicken, die uns unterweisen! Dann würde alles besser sein."
Wir treten wieder hinaus ins Freie und treffen einen Mann, der schlendernd daherkommt und verwundert vor uns stehen bleibt. Er ist der Besitzer jener Villa, unten am Eingang von Kinnereth. 'Bedauere, daß ich Sie nicht empfangen werde," sagt er mürrisch und beleidigt, ehe noch jemand ein Wort gesprochen hat, 'ich bin es gewohnt, daß man mich zuerst besucht, wenn man nach Kinnereth kommt." Ich höre nur das Verlangen des Einsamen nach Aussprache, dieses sehn-süchtige Verlangen, das sich mit solch grober Rede maskieren möchte und sich dennoch verrät. Ich ant-worte nicht darauf, sondern beginne von der Kolonie zu sprechen, von ihrer herrlichen Lage, von ihren Möglichkeiten und von der Armut ihrer Bewohner. Er macht ohne weiteres Kehrt und geht mit mir. Er gibt bereitwillig Auskünfte, schimpft auf die Begriffstützigkeit der Leute, lobt ihre Treue, ihre Ausdauer, ihren Fleiß und spricht sehr klug.
Sein Bruder besaß diese Villa und das Gut, das damit zusammenhängt, hat alles erbaut und bewirtschaftet. Als der Bruder starb, kam dieser Mann nach Palästina, aus Norddeutsch-land, ein Ingenieur, und lebt nun hier, nimmt sich der Farm an. Da wir vor der Villa anlangen und ich mich verabschieden will, ladet er mich flehentlich ein, ins Haus zu kommen. Seine ersten Worte hat er ver-gessen. Wir sitzen in seinem Arbeitszimmer, nachdem er mir die schönen Kulturen gezeigt hat, die er pflegt.
{244} Es ist behaglich hier, im Zimmer. Denn große Bücher-schränke stehen da, ein Klavier und bequeme Korbfauteuils. Wir trinken kühle Limonade, rauchen Zi-garetten und er erzählt lebendig, fesselnd, von den Mühen der Arbeit, von dem Schabernack, den die jungen Araber gelegentlich verüben, von den Repres-salien, die er dagegen anwendet und die ebenso wirk-sam wie geistreich sind. Während ich ihm zuhöre, empfinde ich eine mehr und mehr wachsende Hoch-achtung vor dem strengen, einsamen Leben, das er hier führt und vor der elastischen Energie, mit der er dieses Leben meistert.
Da ich nach Degania fahre, nehme ich ihn mit, denn er will nach Samach, und es ist nur noch ein kleines Stückchen weiter zu dieser Bahnstation. Es geht die sonnige Straße entlang, beständig dicht am Seeufer. Wir überholen einen Trupp Männer, die langsam und schwerfällig schreiten. Sie haben den Turban um den Kopf gewickelt, haben große, wilde Barte und tragen die Füße, tragen die Beine bis ans Knie in dicke Fetzen gewickelt. Das sind Mekkapilger, die von weither ge-wandert kommen. In Samach werden sie wohl eine Strecke lang die Bahn benützen.
Wir passieren die enge, schwanke Jordanbrücke, genießen den Zauber dieser an Gebüschen reichen, vom Wasser durchzogenen Landschaft, und sind bald in Samach. Es ist nichts als die Kurve eines Schienen-stranges, ein paar niedere, hölzerne Häuser, ein kleines, buntes Getümmel von Arabern, Kamelen, Pferden und Warenballen, sehr viel Staub und sehr viel Sonne.
{245} Mitten im Grün seiner Bäume, seiner Sträucher und Blumenbeete liegt Degania mit großen, schönen, steinernen Häusern, mit dem weiträumigen Wirt-schaftshof, den umfangreichen Ställen und Stadeln. So wie diese Gemeinwirtschaft, die sich bewährt hat, werden die anderen Gemeinwirtschaften einmal aus-sehen, Ain Charoth und Tel Josef und Beth Alpha und die anderen alle, die jetzt noch in Zelten und Bretterhütten kampieren. Steht man auf dem Dach des einen großen Wohnhauses und blickt über die Baum-wipfel, dann sieht man in mäßiger Ferne wieder solche Bauten, wie hier, weiß vom Sonnenglanz über-schüttet und vom Baumwuchs noch nicht so umhegt. Das ist Degania II, hervorgegangen aus dieser Sied-lung da.
Das Dach stellt einen luftigen Saal vor, überschirmt von Holzwerk und es dient zur Sommerzeit als Schlaf-stätte. Denn die Hitze wird hier so glühend, daß selbst ein wiederholtes Baden im nahen See nur wenig er-frischt, und daß es während der schwülen Nächte un-möglich ist, in der kochenden Luft der Zimmer zu bleiben. Die Menschen magern ab in der Backofen-Atmosphäre des Sommers, verlieren gewöhnlich zwölf bis vierzehn Pfund ihres Gewichtes, dorren aus. Der schöne, hünenhafte junge Mensch, der mit mir auf dem Dach steht, wird ganz schwermütig, während er mir von der heißen Zeit und ihrer Mühsal erzählt.
Im Speisezimmer fällt mir neben dem Bildnis Theo-dor Herzls und neben anderen Bildnissen, die Photographie eines Knaben auf. Er ist von arabischen {246} Wegelagerern ermordet worden, als er nachts für eine Kranke um den Arzt ritt. Sie wollten ihm das Maul-tier nehmen und hätte er es ihnen lassen, sie würden ihn wahrscheinlich nicht getötet haben. Allein der Junge kannte seine Pflicht und hielt an ihr fest. Er stieg aus dem Sattel und trieb das Maultier mit Schlägen fort, daß es wieder heimlief. Da schössen sie ihn nieder. Er war noch nicht sechzehn.
Im Schulzimmer finde ich zwei kleine Jungen von fünf oder sechs Jahren. Der eine liegt mit kunstgerecht verbundenem Kopf auf einem Sofa, der andere sitzt dabei und behütet ihn. Es sieht lustig aus in diesem Schulzimmer, nach fröhlicher Kinderarbeit und nach der vernünftigen Güte eines väterlich geduldigen Lehrers. Auf Regalen stehen Bücher, auch Bücher zum Spaß und zur Unterhaltung. Alle Kleintiere der Gegend sind da gesammelt und präpariert. Alle Schmetterlinge, Käfer und sonstige Insekten, alle Arten von Spinnen, Skorpionen und, in Spiritus verwahrt, alle Schlangen, besonders die giftigen, die in Degania vorkommen. Dann hängen Bilder an den Wänden, von den Kindern verfertigt, Klebearbeiten und heitere Scherenschnitte. Man braucht sich hier nur umsehen und weiß, was die Kinder alles lernen, weiß auch, wie sie unterrichtet werden. Der eine von den zwei kleinen Jungen, der den Verband trägt, hat sich ein Loch in den Kopf ge-schlagen. Er ist ganz munter und lacht des Unfalls. Doch er muß hier still liegen, damit er sich kein zweites Loch schlägt, noch ehe das erste geheilt ist.
{247} Der andere bewacht ihn und sie spielen ganz ruhig zu-sammen.
'Wo ist der Lehrer?" frage ich sie. 'Auf dem Feld, zur Arbeit." 'Und wo sind eure Eltern?" 'Auf dem Feld, zur Arbeit." Das ganze Haus steht leer. Nur die beiden kleinen Kinder sind hier, im Schulzimmer. Sie denken nicht daran, Unfug zu treiben. Dieses Schul-zimmer umgibt sie mit einem milden, heiteren Ernst und sie haben das Verantwortlichkeitsgefühl, haben das Pflichtbewußtsein, das hier in den Herzen der Kinder schon aufwacht. Alle Türen im ganzen Haus stehen offen. Man blickt in die Stuben der Ver-heirateten, blinkend von Reinlichkeit. In einem anderen Haus wohnen die Ledigen und bei ihnen herrscht dieselbe exakte Ordnung. Im ebenerdigen Ge-bäude des Speisesaales ist die Küche. Da wird jetzt die Mahlzeit bereitet. Nebenan das Haus, wo die Säug-linge und die ganz Kleinen gepflegt werden. Alles so blank und so peinlich sauber, weiß in weiß, wie in einem Sanatorium.
Des Abends, da ich in Tiberias vor dem Hotel pro-meniere, um den Vollmond wieder zu erwarten, be-grüßt mich ein Hund. Keineswegs mit Jubel oder mit Zärtlichkeit. Seine kalte Schnauze berührt meine Hand nur ganz kurz und er schaut mir in die Augen, als ob er sagen wollte: 'Wir kennen uns ja." Gewiß, wir kennen uns flüchtig. Es ist der Stallpintscher von der Table d'hote in Nazareth. Da steht auch schon der Amerikaner vor mir und ist diesmal gleich sehr freundlich. Er entschuldigt sich überflüssigerweise, {248} daß er immer mit dem Hund reist. Aber er wäre sonst zu einsam. In Amerika wollte er das Tier nicht zurück-lassen, als er vor zwei Jahren herüberkam.
'Vor zwei Jahren?"
Allerdings, er ist nun schon an die zwei Jahre hier in Palästina. Führt ein Hilfswerk für die Armenier und erzählt mir, wie dieses arme Volk unter furcht-baren Grausamkeiten dezimiert wurde, was für Tra-gödien sich abgespielt haben und immer noch ab-spielen.
Es ist entsetzlich. Da er meine Teilnahme und meine Bewegtheit merkt, fragt er mich: 'Welcher Kirche gehören Sie an?" Auf meine Antwort bricht er los: 'Es ist traurig mit den Juden ... es ist sehr traurig!"
Und da ich mich erkundige, was denn nach seiner Meinung so sehr traurig sei, haspelt er eine alte Litanei herunter, die gerade hier zu hören, mich ver-blüfft. Ja, die Juden können nur in Städten leben, sie können nur Schacher treiben, und sie seien zu jeglicher Händearbeit ganz untauglich. Die landwirtschaftlichen Versuche, die sie hier angestellt haben, seien elend gescheitert, die Kolonien seien alle verlassen und wüst. Als ich ihm sage, daß es hier, am Tiberias-See allein etwa ein halbes Dutzend blühender Siedlungen gibt, daß er im ganzen Land ungefähr hundert Kolonien in vollster Arbeit sehen könne, und daß ihrer immer mehr entstehen, starrt er mich sprachlos an und glaubt, ich halte ihn zum Besten. Und er lebt zwei Jahre in Palästina.
Er ist mit diesem merkwürdigen Begriff bei so langem Aufenthalt im Lande freilich ein sonderbares {249} Exemplar. Aber man braucht sich eben nicht zu wun-dern, daß Leute, die eine Woche oder zwei in Palä-stina verweilen, zu denselben voraussetzungslosen Eindrücken und Kenntnissen gelangen, wie mein guter, alter Amerikaner. Cooks Reisebureau führt hier nur zu den heiligen Stätten und Sehenswürdigkeiten und hat sich bisher geweigert, einen Dienst für die jüdischen Kolonien einzurichten.
Die arabischen Fremdenführer gehen selbstverständlich an allem Jüdischen vorbei. Die arabischen Chauffeure 'kennen" die Kolonien 'nicht", 'wissen nicht", ob es welche gibt, noch wo sie liegen. Oder sie bringen ihre Fahr-gäste an irgend ein verfallenes, verlassenes Araber-dorf und sagen, das sei eine jüdische Siedlung. Damit sprechen sie nur halb die Unwahrheit. Denn gewöhn-lich ist es ein Dorf, dessen Boden vom jüdischen Sied-lungsfonds erworben wurde, worauf die Araber nach Transjordanien ausgewandert sind. Das verlassene Dorf ist noch nicht jüdische Kolonie, wird es später erst. Aber der Eindruck von Verfallenheit, den es übt, setzt in den Besuchern die Meinung fest, das Auf-bauwerk sei ganz mißlungen.
Im Hotel Allenby zu Jerusalem saßen eines Abends zwei jüdische Männer, die aus Amerika gekommen waren, um hier die Arbeit ihres Volkes kennenzulernen. Sie mußten den nächsten Morgen abreisen und befanden sich in großer Betrübnis. Denn sie hatten, so lange sie in Palästina weilten, nichts zu Gesicht gekriegt, als solche famose Trümmerstätten, die man ihnen als Kolonien zeigte. Dieser letzte Tag aber hatte ihnen den Rest gegeben.
{250} Sie hatten an diesem letzten Tag durchaus Tel Awiw sehen wollen. Wohin der arabische Chauffeur sie ge-fahren, was für Trümmer und Ruinen er ihnen als Tel Awiw bezeichnet hatte, ließ sich nicht ermitteln. Genug, die beiden saßen abends im Allenby-Hotel, hielten den Aufbau Palästinas für Schwindel und Humbug, und waren traurig.
Als man sie aufklärte, daß sie selbst das Opfer plumpen Humbugs gewesen seien, konnten sie nichts mehr machen, denn sie mußten ja am ändern Morgen abreisen.
{251}
XXVIII
Der Weg von Tel Awiw durch die Scharon-Ebene, längs der Meeresküste, nach Haifa, führt erst an Sarona vorbei, an der Siedlung deutscher Templer. Sie war einst musterhaft, diese Siedlung, ehe die deut-schen Kolonisten von den Engländern ausgewiesen wurden. Und sie wirkt jetzt noch mustergültig mit ihren wohnlichen Häusern, ihren gepflegten Kulturen. Dicht dabei grünt der Montefiore-Garten, der schon vor siebzig Jahren angelegt wurde, eine landwirt-schaftliche Lehrstätte für die Juden Palästinas. Nun folgt Orangenhain auf Orangenhain in dieser frucht-baren Scharon-Ebene, deren Üppigkeit und Blumen-fülle Salomo im Hohen Lied besungen hat. Dann überschreitet man den Jarkonfluß und hat einen weit-hin gestreckten Wald vor sich, einen wirklichen, rich-tigen Wald, den ersten und einzigen, den ich in Palä-stina erblickte. Das ist die Kolonie Pethach Tikwa.
Sie liegt mitten im gehegten Dickicht dieses Waldes. Man fährt durch umgrünte, wipfelüberrauschte Straßen zu ihren Häusern. Die niedrig gehaltenen Orangenbäume hängen in ihren dichten, breiten Laub-kronen voll großer, rotgoldener Früchte, an den Zitronensträuchern prangt goldgelb die Fülle der {252} Frucht und zugleich treiben überall schon die stark duftenden Blüten hervor. Hohe Akazien säumen diese Pflanzungen, Kaktushecken oder Lorbeergebüsch schließen sie in Parzellen gegeneinander ab. Man fährt lange durch diese glücklich grünende, selig reifende, berauschend duftende Welt. Alle Frühlingsträume, die einem je durch die Seele zogen, sind hier Wirklich-keit, mit Vogelsang, blauem Himmel und Sonnen-schein. Wasserläufe vom Jarkon ziehen sanft und dunkeln spiegelnd zwischen den Bäumen. Mühlen sind im Gang, zu denen Esel Säcke heranschleppen. End-lich Häuser. Ein Städtchen liegt da, klein und an-heimelnd, poetisch und behaglich. Da ist die Post, wo die Wagen der Diligence halten, wie einst in fernen Zeiten. Da ist die Poliklinik, dabei die Apotheke, da ist die Synagoge und da sind die Schulen. Der Platz wird frei, die Bäume treten mehr zurück und man sieht in der Ferne die Berge von Judäa.
In Zufriedenheit scheint hier das Leben sacht dahin-zugehen, in Ruhe und Wohlstand. Pethach Tikwa, das nun bald fünfzig Jahre besteht, hält seine Jugend bei sich, siedelt frische, ins Land gekommene Jugend an. Ein neues Viertel erhebt sich, anschließend an das alte Städtchen. Und ein Trupp junger Mädchen aus Österreich hat eben erst eine kleine Gemeinwirtschaft hier begonnen.
Ich esse allein in dem Hotel, das tief in einem dicht verwachsenen Garten steht, von Myrthen-, Orangen- und Lorbeergebüschen umblüht. Man setzt mir eine viel zu reichliche, ausgezeichnete Mahlzeit vor und {253} es ist, als sei ich bei einer gut bürgerlichen Juden-familie zu Gast.
Nur die Leute erscheinen mir bedrückt. Die Haus-frau, die mich bedient, der Wirt, der manchmal durch das Zimmer geht. An der Wand entdecke ich das Bild-nis eines jungen Mannes und besinne mich der tra-gischen Geschichte, die mir erzählt worden ist. Vor wenigen Jahren haben fünftausend Araber Pethach Tikwa überfallen. Politisch fanatisiertes Volk aus Tul Kerem und anderen umliegenden Ortschaften. Etwa dreißig junge Menschen der Kolonie wehrten den An-griff ab. In guter Deckung hinderten sie die Araber, das Städtchen zu stürmen, es zu plündern und ein Blutbad anzurichten. Aber es dauerte stundenlang, ehe Flieger aus Ludd, ehe Truppen aus Jaffa zum Entsatz herbeikamen. In diesem stundenlangen Feuergefecht wurde der Sohn des Wirtes erschossen. Chaim Mandelbaum zeigte mir, als wir abfuhren, die Stelle, an welcher der Unglückliche in Deckung lag. Jetzt ist ein Denkstein da errichtet. Er zeigte mir auch den Heustadel, den die Araber erkletterten, um vom Dach aus in die Deckung zu feuern. Dem Sterbenden hackten sie die Füße ab, schlitzten ihm den Leib auf und preßten die Füße, die noch in den Schuhen steckten, hinein. So wurde er gefunden.
Als ich nach beendigtem Mahl in der Türe der Glasveranda stand und zum Garten niederschaute, ge-sellte sich der Wirt stumm und höflich zu mir. 'Es ist wunderschön hier ...", sagte ich endlich und nahm {254} Abschied. Er seufzte schwer: 'Oh ja... schön ist es... aber teuer erkauft."
Den Rädelsführer jenes Überfalles nahm man fest, stellte ihn vor Gericht und er wurde zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt. Aber kaum ein Jahr war noch verflossen, da richtete die Gemeinde Pethach Tikwa für ihn ein Gnadengesuch an die Regierung, dem der High Commissioner augenblicklich Folge gab. Der Mann wurde freigelassen und erschien mit anderen arabischen Politikern bei einem Friedens-mahl, das ihm von den jüdischen Führern gegeben wurde. Dort hat er aus eigenem Antrieb einen Schwur geleistet, nie wieder gegen Juden oder Judenarbeit die Hand zu erheben. Und ein Araber hält seinen Eid.
Diese Politik des Friedens und der Versöhnlichkeit ist die einzig richtige, die von den Juden getrieben werden kann. Sie entspricht dem jüdischen Herzen, dem jüdischen Geist, entspricht den wahren, mensch-lichen Geboten. Hier, auf dem Boden ihrer Urheimat dürfen die Juden nicht als eroberungslustige Euro-päer auftreten, dürfen nicht Gewalt gegen Gewalt setzen wollen. Dürften es selbst dann nicht, wenn sie die volle Macht dazu hätten. Denn sie werden hier für immer mit den Arabern leben, mit den Arabern in Palästina, wie mit denen der ganzen, großen, angren-zenden Länder. Sie legen jetzt den Samen in den Boden und in die Herzen für dieses immerwährende Zu-sammensein mit den Arabern, und wenn sie jetzt Haß oder Vergeltung säen, werden sie niemals Liebe, oder auch nur Duldung ernten. Sie müssen sich brüderlich {255} dem semitischen Volk der Araber nähern, die ihre Brüder sind. Sie müssen ihnen sagen, daß Gott sie zurückgeführt hat, nach Palästina, daß sie nach Gottes Willen zurückgekommen seien. Und es genügt nicht, ihnen das bloß zu sagen, sie müssen durch ihre Hal-tung beweisen, daß der Geist Gottes in ihnen lebendig ist. Dann werden ihnen die Araber glauben und es wird langsam Friede einkehren zwischen ihnen. Immer müssen sich die Juden das vor Augen halten. Es ist eine ihrer größten Aufgaben hier in Palästina und im Angesicht der ganzen Welt. Von der Erfüllung dieser Aufgabe hängt das Gelingen ihres ganzen Werkes ab. 'Teuer erkauft", werden manche sagen. Aber es kann nicht zu teuer erkauft sein!
Von Pethach Tikwa komme ich nach langer Fahrt durch die Scharon-Ebene, an der finsteren, festungsartigen Araberstadt Tul Kerem vorüber, des Morgens in die Fluren von Benjamina. Auf dem Weg dahin fahre ich durch üppige Saaten, über schwellenden Weidegrund. Schildkröten marschieren dann und wann feierlich quer über die Straße. Im Korn werden Gazellen hoch und jagen vor mir her, pfeilschnell, leicht und anmutig.
Flach ist der Boden von Benjamina, fett und frucht-bar. Der einzige Sohn eines hochverehrten, lieben Freundes wohnt hier als Siedler seit ein paar Jahren. Ich treffe ihn, wie er gerade zu seinem Acker hinaus-fahren will. Er ist der junge Mann, der mir gesagt hat, er sei am Ziel seiner Wünsche, und der mir durch diesen Ausspruch den tiefsten Eindruck gab, mir, der {256} sein Vater sein könnte und der sich noch lange nicht am Ziel seiner Wünsche fühlt. Wir sitzen in seinem kleinen Haus beisammen und er spricht zögernd, überlegt, doch zutraulich dabei. Sein Wesen ist hell und ernst, ist voll Güte und ohne Sentimentalität. Als geschulter Landwirt hat er einen ausgezeichneten Ruf, beinahe Autorität im ganzen Land.
Er hat zu aller Sachkenntnis einen eisernen Fleiß, er ist ganz bedürf-nislos und dennoch kämpft er um das wirtschaftliche Gleichgewicht seiner Existenz. Das kommt daher, daß die Bewässerung Benjaminas, die versprochen wurde, bisher nur zum kleinen Teil durchgeführt ist. Deshalb kann er eben nur den kleineren Teil seines Acker-grundes erfolgreich bebauen. Auch der Transport der Lebensmittel, die er verkaufen könnte, klappt noch nicht recht. Er hätte Milch, Butter, Eier und Gemüse zu versenden. Der Blumenkohl, den er zieht, ist fast doppelt so groß, wie bei uns, die Krautköpfe sind vier-zehn bis sechzehn Pfund schwer. Aber da sie nicht an den Mann gebracht werden können, lohnt es nicht, sie zu bauen.
Dabei hätte Jaffa ebenso wie Haifa Be-darf genug an all diesen Dingen. Und Benjamina liegt in der Mitte, ganz nahe an der Eisenbahnstation. Den-noch klappt die Sache nicht recht. Schwierigkeiten des Anfangs. 'Aber ich bleibe!" sagt er. 'Selbst wenn alle Aufbauarbeit mißlingen sollte - sie wird nicht mißlingen, ich hoffe es zuversichtlich! - aber gesetzt den Fall, daß alles hier zu Rande kommt. . . ich bleibe!" Er spricht mit solch einfacher, mit so fester Entschlossenheit, daß man überzeugt ist, er würde eher sein {257} Leben, als seine Erde lassen. Er hat eine brave junge Frau, tapfer und tüchtig wie er selbst. 'Für meine Frau, für mich und die Kinder werde ich hier immer genug haben", sagt er. Dann hält er inne, runzelt die Stirne, überlegt und fährt fort; indem er mir offen ins Auge schaut: 'Die Kinder ... wenn sie hier blei-ben .. . dann ist genug für sie da. Wenn sie aber nach Europa wollen... müssen sie sich die Mittel dazu eben selbst schaffen." Ein ganz freier, ganz unab-hängiger Mensch ist dieser junge Mann, ganz reif, ganz in sich geschlossen, bedingungslos dem Boden hinge-geben, zu dem von Kindertagen her seine Sehnsucht ging. Ich wollte, es wären so wie er ein paar Tausend hier im Land. Aber so brav, so begeistert und so tüch-tig sie alle auch sein mögen, wie er ist eben unter Tausend nur einer.
Den Felsen fahren wir empor, auf dem hundertsiebzig Meter hoch Sichren Jakob liegt. Eine alte Kolonie, die sich mit der Hilfe des Barons Rothschild behaupten und zu wirklichem Gedeihen entwickeln konnte. Heute ist Sichren Jakob eine Ortschaft von tausend Einwohnern. Schöne Häuser, stehen ein-stöckig, selbst zwei Stockwerke hoch, in wunder-schönen Gärten. Gepflegte Straßen laufen kreuz und quer über den Felsengrund, in den die ausgedehnten Weinkellereien gehauen sind. Sie bauen Wein hier, ziehen Mandeln und Oliven und treiben Ackerbau.
Ein herrlicher Ausblick öffnet sich hier oben nach allen Seiten. Hier sehe ich zum erstenmal den Höhen-zug des Karmel, der mit breitem Rücken, zerklüftet, {258} gegen Nordwesten zeigt. Unten grünt und gelbt die Ebene. Gerändert, wie Teppiche liegen Äcker neben-einander, und dort drüben, dem Auge so nahe, daß man den feinen weißen Schaumkranz sieht, mit dem die Wellen den Ufersand küssen, atmet das Meer. An der Küste ragt abenteuerlich und verfallen die mar-morne Ärmlichkeit von Cäsarea. Überall zerstreut jüdische Siedlungen.
Ein Großgrundbesitzer hat hier oben, auf der West-seite des Felsens von Sichren Jakob sein Gut. Ein Wirtschaftshof mit Ställen und Scheunen, mit Wagen, Pferden, Eseln, Geflügeln und Tauben wirkt herrschaft-lich.
Und herrschaftlich ist das Wohnhaus, dessen Front dem Meere sich zuwendet. Ein großer, wunder-bar angelegter und sorgsam gepflegter Park umgibt das Haus und gleitet, blumenbesät, den Felsenhang nieder. Englische Juden sind die Eigentümer und das ganze Interieur, die Zimmer, das Arbeitskabinett des Hausherrn, der Speisesaal, alle Räume sind groß, sind komfortabel schon in ihrer Architektur und haben die eigentümlich ruhige, englische Behaglichkeit. Auf dem Dach erfreute ich mich des herrlichen Rundblicks und sehe die Sonne ins Meer sinken. Dann gehe ich, noch während die Glutfarben des Sonnenabschieds leicht zur Dämmerung ergrauen, mit der Dame des Hauses durch den Park. Hoch, wie Sträucher stehen weiße Margueriten, purpurn leuchtet der Flox, in prächtigen, rotvioletten Kissen lagert blühende Bougainvillea auf pergolaähnlichen Stützen, Lilien prangen in holder Strenge, 'die Lilien von Scharom" des Hohen Liedes.
{259} Die Schwester der Dame ist hier Hausfrau gewesen, hat die Blumen geliebt und den Park betreut. Seit sie allzu früh verstarb, werden Park und Blumen zu ihrem Andenken weiter gepflegt.
In der Abendstille streife ich durch die Ortschaft. Sonderbar, erregend und zugleich beschwichtigend fließen Eichendorffsche Stimmung und Stimmungen von Hafis ineinander. Während ich an dem Frieden der Häuser vorüberwandle, die verschlafen dastehen, eingewiegt vom Rauschen der Bäume, ziehen mir Heimatklänge durch den Sinn und Erinnerungen an die Bibel. Es ist Freitag, Vorabend des Sabbat, und die Pforten der Synagoge sind geöffnet. Ich trete ein und komme noch zum Ende der Andacht. Festliche Be-leuchtung verbreiten die Lampen des Kronleuchters. Diese Menschen hier, wie nah sind sie mir alle und wie vertraut. Wie kenne ich diese von Kummer vor der Zeit gebeugten Rücken der Männer; wie viel dul-dende Rechtschaffenheit spricht aus dieser Linie, die vom Hals bis zu den Schulterblättern sich krümmt. Und wie lösen sich im ungestümen Modulieren der Gebete, im melancholischen Singsang ihre zärtlichen Sorgen, Trauer, Hoffnung, unerschütterliche Zuver-sicht und treues Ausharren.
Wer sieht nicht in einer Kirche, in einer Moschee oder in einem Tempel die guten Eigenschaften seines Volkes? So fühle ich hier die guten Eigenschaften des meinigen, weiß aber zu-gleich, daß sie diesem Volk nicht ausschließlich ge-hören, daß ich im Dom zu Trient, in der Hagia Sophia zu Konstantinopel von dem Anblick der Betenden {260} fast ebenso gerührt wurde. Empfinde es sehr stark, daß man nicht die Menschheit würdigen kann, wenn man nur sein eigenes Volk liebt, daß man aber sehr wohl sein eigenes Volk im Herzen zu hegen vermag, wenn dieses Herz sich allen Menschen ohne Unterschied er-schließt. Was mich hier ergreift, in der Synagoge auf dem Felsen von Sichren Jakob, ist nicht die Besonder-heit meines Volkes, nur die Besonderheit des Juden-schicksals, dem ich untrennbar verknüpft bin.
Nachher sitze ich noch lange vor der Synagoge unter den hohen Bäumen der Gartenanlage. Der Ster-nenhimmel ist vom schwachen Schimmer der Mond-sichel lichter getönt. Ein Nachtvogel schreit klagend, hin über den Zweigen. In dem netten kleinen Hotel sitze ich dann mit Chaim Mandelbaum beim Abend-essen, und ein schmales, feines Wesen bedient uns. Unglaublich schüchtern, sanft und kaum merklich, wie ein Schatten. Nach dem Gesicht, das adelig schmal und braun ist, eine Yemenitin. Ich glaube, daß sie ein Kind sei, etwa zwölf, höchstens vierzehn Jahre alt. Doch Mandelbaum lacht und sagt, sie sei eine Frau, die gewiß schon ein paar Kinder geboren habe. Wir sind beide im Irrtum. Der Wirt erzählt, sie sei schon fünfzehn Jahre bei ihm, sei über Dreißig, uner-müdlich bei der Arbeit, aber menschenscheu.
Was geht in solch einem rätselhaften Geschöpf vor? Halb ein Kind noch, tritt sie in den Dienst, haspelt Jahr um Jahr in ewig harter Arbeit ab, spricht mit nieman-dem, hockt an Festtagen allein in ihrem Winkel, wird {261} alt und stirbt schweigsam, wie sie schweigsam ge-lebt hat.
Eben, da ich schlafen gehen will, kommen ein junger Mann und eine junge Frau herein und fordern mich auf, zu ihnen zu gehen, um den Abend zu ver-plaudern. Beide sind ungewöhnlich sympathisch und ich willige mit Freuden ein. Die junge Frau ist die Gattin des Direktors der Nationalbibliothek in Jeru-salem Dr. Bergmann und sie weilt hier zu Besuch bei einer kranken Freundin. Der junge Mann ist mit dieser Freundin verheiratet und wohnt als Gärtner auf dem Großgrundbesitz, den ich nachmittags besucht habe. Durch die Dame dort wissen sie von meiner Anwesen-heit. Wir gehen den Weg, den ich nun schon kenne, treten in den Wirtschaftshof und sitzen dort in einer Wohnküche zu ebener Erde beisammen. Einfacheres läßt sich nicht denken. Wir trinken Tee, rauchen Zigaretten und plaudern. Der junge Gärtner ist ein zarter, unbewußt lyrischer Mensch, der über prak-tische Dinge und politische Probleme nicht viel Be-scheid weiß. Aber er hat eine innige Sachlichkeit, wenn er von den Pflanzen und Blumen spricht, er hat so viel feinen Geschmack und eine so auserlesene Kultur, daß man entzückt aufhorcht, wenn er redet. Er besorgt den Park hier oben und findet, daß es in der Welt wenig schöneres gibt, wie Gärtner in Sichren Jakob zu sein. Das sagt er freilich nicht mit Worten, doch man liest es ihm von den sanften Augen, von dem hübschen blassen Gesicht und man hört den Wiederklang dieses Glückes aus seinen Reden.
{262}
XXIX
Der Karmel ragt als ein Kap ins Meer. Gegen Süden deckt er Haifa, wie ein kolossaler Wandschirm, so daß man die Stadt nicht sehen kann. Wir fahren in der Ebene, immer näher und näher zur Küste. Chaim Mandelbaum vollführt in dieser Heide, in der jeder Weg alle Kilometer lang abreißt, wahre Bravouren. Bald wird der Boden sumpfig, bald wieder sperren Gräben quergezogen das Terrain, bald wieder liegen Trümmer, Quadern, rohe Steine, massenhaft umher, durch die das Auto balancieren muß, in einer Art von Eiertanz.
Nach langer Fahrt sind wir endlich dicht am Meer. Über uns steilt die zerklüftete, höhlendurchwühlte Stirne des Karmel hoch empor. Die Straße wendet sich und da liegt die Bucht, da liegt die Stadt Haifa vor uns. Ein Anblick, fast so hinreißend, wie der Anblick von Neapel. In das Grün der Berge geschmiegt, an den Rücken der Berge gelehnt, am Meeresstrand hinge-streckt, ... eine verführerische holde Wohnstätte, ein Aufenthalt, in dem man sein Zuhaus vergessen könnte, eine Szenerie, in der das Heimweh eingelullt wird und schweigt, eine Stadt, die zur Arbeit beschwingt und zum Genuß. Ganz offen, in jedem Moment überblickbar {263} sind die Übergänge von der Geschlossenheit schmaler, ineinander geschachtelter Häusergassen zur freien Natur, zu den Gärten, Wiesen und Wäldern. Und faszinierend, wie am Gestade von Neapel, wie in allen Hafenstädten, die an solch einem Golf liegen, die vor den Häusern aufgerollte unendliche Freiheit des Meeres, die von allen Fernen redet, in alle Fernen lockt. Weithin schimmert der Strand in der köst-lichen Schwunglinie eines Halbkreises, der sorgsam ab-gezirkelt scheint, und das hell blinkende Geschmeide der Häusermassen wirkt wie lebendiger Schmuck in der lebendurchglühten Landschaft. Weit weg, am an-deren Ende der Bai, jenseits der hellgrünen Wiesen-streifen, der die Stadt dort gürtet, blitzen und fun-keln, hingesetzt wie ein Juwel zum Abschluß, die Mauern von Akko, der Festung, dicht über dem Wasser.
Die Straßen des alten Haifa sind herrlich durch-wimmelt von farbiger Geschäftigkeit, sind prachtvoll schmutzig und abenteuerlich in ihrer Fülle levantinischer Gestalten. Zum Karmel hin, dem Weg ent-gegen, auf dem ich kam, dehnt sich über weißen Dünensand ein neues, großes Wohnviertel, das jetzt im Bau begriffen, später wichtige Bedeutung haben wird. Da steht das umfangreiche Gebäude, das die jü-dischen Einwanderer zunächst herbergt, ehe sie ins Land an ihren jeweiligen Bestimmungsort dürfen oder können. Da stehen Einfamilienhäuser und sind schon bewohnt, obwohl der Dünensand, in den man versinkt, noch nicht zur Straße geebnet ist. Da werden {264} andere Villen gebaut, fast so viele, fast so schnell, wie in Tel Awiw. Und sie alle warten der nahen Zeit, in der Haifas monumental angelegter Hafen der große Handelsplatz, das umdrängte Eingangs- und Ausgangs-tor für Palästina sein wird.
An den nordöstlichen Hängen des Karmel fügt sich auf gepflegten Alleestraßen die deutsche Kolonie zu Haifa, und wenn man an ihren Biedermeier-Häusern vorübergeht, die aus den sechziger Jahren stammen, ist man plötzlich irgendwo in Thüringen, etwa in Eisenach.
Auf der Hügelhöhe steht das jüdische Polytech-nikum, breit und dominierend über der Stadt. Sein großer Garten, vor ihm niedergebreitet, schafft Raum und der monumentale Bau hebt sich würdevoll aus dem Quartier neuer, hübscher Häuser, das ringsumher den Hügel erklettert hat.
Ich fahre zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben ist das neue Hotel, Herzlia, eben eröffnet worden und ich will da wohnen. Eine kühn angelegte Straße bezwingt den Berg des Propheten Elias im entschlos-senen Anstieg einer steil ansteigenden, geraden Linie, die bis zur Kaphöhe aufwärtsdringt, immer ganz dicht an den Bergrücken geschmiegt, immer ganz hart am jählings niederstürzenden Abgrund vorbei. Das Auto saust die Steigung hinauf, beinahe hätte ich ge-sagt, es jubelt. Je höher man kommt, je mehr wird einem zum Jauchzen und diese Trunkenheit der Seele ernüchtert auch dann nicht, wenn sich manchmal für kurze Sekunden die kleinen Nebelschleier eines {265} Schwindelgefühls um Augen und Sinne legen, sie ge-hören mit dazu. Sie würzen den Rausch nur noch stärker, der einen erfüllt, wenn man mit so rasender Schnelligkeit fünfhundert Meter emporgerissen wird, über die Stadt hinaus, die kleine und spielzeugähnliche Formen annimmt, während sie von Minute zu Minute tiefer und tiefer sinkt; über die Schiffe im Hafen, die winzigen Modellen gleichen, wie man sie in hansea-tischen Stuben sieht, und über das Meer, das immer mächtiger, immer gewaltiger sich aufrollt.
Diese heroische Prachtstraße haben die Karmelitermönche bauen lassen und sie heben eine Wegmaut dafür ein. Vom Kloster ab, das reich und schön ist, wie nur irgend ein erlauchtes Stift in Europa, wendet sich die Straße zur Mitte des Berges, und ersteigt den Gipfel. Üppige Gärten blühen zu beiden Seiten des Weges. Man kommt durch lichten Wald und blickt in bewaldete Klüfte, von denen es heißt, daß Hirsche darin leben und Leoparden. Man fährt an Villen vorbei, auch an der Villa jener englischen Dame, die hier mit großem Eifer alle Agitationen und Intrigen gegen das jüdische Aufbauwerk leitet. Endlich sind wir am Hotel. Ein schöner, moderner Neubau, mit Balkons und Terrassen mit Halle, Gesellschaftsräumen und an-genehmen Zimmern. Zwei sympathische junge Men-schen führen die Wirtschaft. Die Söhne des Mannes, der unten in Haifa das ältere Hotel Herzlia hält. Sie sind so aufmerksam, daß man sich wunschlos zu-frieden fühlt.
Den Abend verbringe ich mit Hermann Struck, dem {266} Maler und Radierer. Er entstammt einer alten in Berlin ansässigen Familie, er liebt Deutschland, hat den Krieg in der deutschen Armee mitgemacht, er ist kein Jüngling mehr, schon nahe an Fünfzig, er hat eine alte Mutter in Berlin und wenn er von ihr spricht, werden ihm die Augen naß. Dennoch: als wieder Frie-den wurde, zog er nach Palästina. Er mußte. Das Land hier war stärker als alles, war stärker, als er selbst. Nun wohnt er hier mit seiner Frau in einem reizen-den kleinen Haus, nahe dem Polytechnikum. Auch er ist ein neuer Mensch auf alter Erde.
Er ganz be-sonders. Sein Lebensnerv, sein innerstes Empfinden ist diesem Boden hier verbunden. Der größte Teil seines Daseins aber, alle seine Familienbeziehungen, sein geistiges Werden, seine Kultur und seine Kunst wurzeln in Deutschland. Er muß hier künstlerisch um-lernen. Denn das Licht ist hier strahlender als im Norden, die Luft hat hier andere Dichtigkeiten und hö-heren Schimmer; deshalb sind die Farbenwerte hier verändert, ihr Zusammenstoßen wie ihr Ineinanderklingen vollzieht sich unter anderen Gesetzen und die Schatten haben hier andere Valeurs. Ein menschlicher Zustand wie der von Hermann Struck ist frei-lich kompliziert, doch er gehört unter Juden keines-wegs zu den Seltenheiten. Jeder von uns, der sich überzeugt und entschieden zu seinem Judentum be-kennt, beschwört in seinem Innern Komplikationen herauf, wird in seinem Verhältnis zur Welt, in der er lebt, zur landschaftlich gefärbten Kultur, der er an-gehört, und an der er Mitarbeit leistet, zum Boden, zur {267} Stadt, die ihn geboren, die ihm Kindheitserinnerung verknüpft, so vom Grund aus erschüttert, daß er all sein Denken, und seine ganze Seele daran wenden muß, um wieder in Harmonie zu gelangen.
Mag also der menschliche Zustand Strucks keineswegs selten sein, so ist doch die Konsequenz, die er bis aufs Letzte daraus gezogen hat, immerhin eine Seltenheit und die Harmonie, in der er lebt, zwischen Glück und Weh-mut, schwebt hoch über dem Alltäglichen. Dieser vor-nehme, elegante Mann, der in Gestalt, Antlitz und Wesen an Theodor Herzl erinnert, dieser Mensch, der ganz modern denkt, der in allen modernen Problemen seine Meinung hat, der so frei, wie ich und andere Menschen von heute, gehört den Misrachi an, den Strenggläubigen und würde nie an einem Tisch essen, der nicht rituell bestellt wäre. Auch er lehnt das Wort Orthodoxie ab, wie Professor Pick, und wie dieser hat auch er nichts vom eifernden Zelotentum an sich. Aber dieser Künstler hängt inbrünstig an Gott, hält uner-schütterlich fest an den Geboten der Bibel.
Wir streifen zusammen den anderen Tag in Haifa umher. Wir sehen am Bahnhof die beiden großen Mühlen, die da stehen, die eine für Getreide, die andere für Öl. Wir stapfen in dem neuen Viertel durch den Dünensand. Wir wandern durch die alte Stadt und- er spricht jeden jüdischen Lastträger an, riesen-hafte Männer, die gutmütig wie die Kinder sind. Er freut sich mit diesen einfachen Menschen, sie kennen ihn alle und man sieht, daß sie sich mit ihm freuen. Er führt mich in eine Art Gemeinschaftsküche, die {268} für misrachische Arbeiter errichtet ist, ein mehr als bescheidenes Lokal, wo wir zur Mittagsstunde ein-treten und wo er von den proletarischen Leuten be-grüßt wird, wie ein guter alter Freund.
Dann ver-bringen wir angeregte Stunden im Polytechnikum. Der Direktor, der ein hervorragender Fachmann ist, wußte die Anstalt schon in Betrieb zu setzen, noch ehe sie recht vollendet war. Da begann in den großen Sälen des Parterres, die als Werkstätten eingerichtet sind, die praktische Arbeit der jungen Leute, mit Maschinenschlosserei, mit Feinmechanik, Elektro-technik und Möbelkonstruktion.
Im herrlichen Garten, als ein Seitenflügel, steht, ein wenig unterhalb des Poly-technikums, das Realgymnasium. Knaben und Mäd-chen werden da in Koëdukation gehalten. Auch ein Internat ist dabei. Der Unterricht findet vielfach im Freien statt und die Kinder bestellen auch den Garten. Architektonisch ist es eine der schönsten Schulen, die es überhaupt gibt. Die Räume, die loggienartigen Kor-ridore, in denen die Sammlungen aufgestellt sind, die Schlafsäle von Jungen und Mädchen, die im Internat leben, die offene Veranda, in der die Kinder die Mahl-zeit einnehmen, alles das ist von einer vorbildlichen freien Schönheit.
Der Unterricht aber, ebenso wie das intensive Studium der Kinder hier atmet eine neue, eine schöne Freiheit.
{269}
XXX
Dann bin ich wieder oben, auf dem Karmel, allein in meinem Zimmer und blicke hinaus in die Unend-lichkeit des Meeres. Eigentlich bin ich ja während dieser ganzen Reise immer allein gewesen. Und doch war ich noch niemals, wohin mich auch sonst mein Weg geführt hat, war noch nirgendwo in der Welt so umgeben und begleitet von Menschen und Erinnerun-gen, so bestürmt von Vergangenheit, so angefeuert von der Gegenwart, wie hier in Palästina.
Hier ist mein Vater bei mir gewesen und meine Mutter; ich habe ihre zärtliche Nähe gefühlt, als seien sie noch unter den Lebendigen. Ja, sie lebten hier, mit mir. Sie saßen an meinem Bett in der Einsamkeit der Nächte, wenn ich in kleinen Herbergen schlief oder in Zelten. Sie saßen an meinem Tisch und sie gingen an meiner Seite durch dieses ganze, heilige Land. Alle meine Ahnen umgaben mich.
Ihre Gestalten sah ich in der Synagoge zu Safed, auf den hellen Straßen von Tel Awiw, und zu Jerusalem an der Klagemauer. Der Hochmut des Gegenwärtigen, des Lebendigen, dieser ungewollte, nichtige Hochmut fiel ab von mir an den Bibelstätten, am Fuß der Gilboahberge, im Anblick des Jordans, der Gebirge von Gilead und auf den {270} Höhen von Hebron, wo die Sonne noch immer genau so strahlt, der Himmel sich noch immer genau so wölbt, wie vor Jahrtausenden.
Da standen die Urväter auf und wandelten lebendig und waren nicht fern, nicht geheiligt, sondern Menschen, leibhaftig, begreiflich, kernhaft tüchtig und schwach dabei, Menschen, die helle Stunden hatten und dunkle; sie alle, von Jakob angefangen, Simson, der fröhliche Starke, Saul, der schwermütig wurde, verzweifelt und gering, weil er das Aufblühen des Größeren, den Sieg der Jugend nicht ertragen konnte, und dann, der Größere, der königliche Dichter David, und alle, alle die anderen. Mit solcher Begleitung zog ich im Morgendämmer einer neuen Zeit durch Palästina und um mich war die Jugend, erschütternd in ihrer opferbereiten Hin-gabe. Wann wäre ich hier allein gewesen? Ich bin es auch jetzt nicht, da die Stadt und das Land tief unten, nun schon weit hinter mir liegen und ich nichts vor mir habe als das Meer, zu dem, einmal noch auf-flammend, die Sonne niederglutet.
'Ich glaube an Palästina und ich glaube an die Zu-kunft!" Unten in Haifa hat es mir der alte Hotel-besitzer gesagt. Er saß bei mir am Tisch, er schüttete mir seine Begeisterung für Theodor Herzl aus, den er in Jerusalem ein einzigesmal gesehen hat, dessen frü-hen Tod er heute noch bitterlich beweint und an dem er die aufweckende, die schöpferische Kraft seiner Dichterseele versteht. Er sagte es, ein alter Mann, der viel erlebt und viel erfahren hat, er sagte es aus der Fülle seiner Lebenserfahrung und aus vollem Herzen:
{271} 'Ich glaube an Palästina, glaube an seine Zukunft." Das war das Letzte, was ich hier hörte.
Es ist auch das Erste gewesen, das ich hier gehört habe. Von dem Augenblick an, da ich ins Land kam, während der ganzen Zeit, da ich hier war, klang es mir von allen Seiten immer wieder entgegen. Als ich aus Ägypten herfuhr, war ich verstimmt, beunruhigt und niedergedrückt, denn der reiche Mann in Kairo hatte überlegen und mit einem bedauernden Lächeln gesprochen: 'Es ist nichts los in Palästina." Aber hier sprach aus Menschenmund der feste, frohe Glaube an Land und Zukunft, hier redete die Erde von ihrem Glauben an sich und an die Menschen, an ihre heim-gekehrten Söhne. Und hier fand ich die Zuversicht wieder, die mich hergetrieben hat, hier wurde sie be-stätigt, wurde erhöht.
Ob die wirtschaftlichen Verhältnisse heute schon so weit gediehen sind, daß von Gewinn, der zu gewärtigen ist, Kapital angelockt werden kann, vermag ich nicht zu entscheiden, weil ich nicht viel davon verstehe. Vielleicht lohnt es, hier Fabriken für Obstkonserven zu bauen. Eine Großsämerei scheint zu fehlen, und vielfach muß wichtiges Saatgut noch von außen ge-bracht werden. Eine umfangreiche Anstalt für Vieh-zucht wäre notwendig, denn immer noch werden Kühe, Ochsen, Stiere aus Syrien, aus Holland und aus der Schweiz kostspielig importiert. Zu den Palästinen-sischen Paradoxen des Herrn van Vriesland gehört auch der Satz, daß die Juden das einzige Volk sind, dem die Aufgabe obliegt, ihre Heimat erst zu erobern. {272} Nun, die friedliche Eroberung will jetzt erst beginnen. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, zum Anfang des Anfangs an Gewinn zu denken. Aber ich weiß, daß ich, als Jude, mich in die Seele hinein schämen würde, nicht nach meinen Kräften am Aufbau von Palästina mitgeholfen und beigetragen zu haben.
Dieses Werk muß so schnell wie möglich so weit gefördert werden, daß sein Gelingen nicht mehr zu hindern ist. Die Araber sind klug, sie sind begabt und sehr gelehrig. Wenn sie den Juden einmal die inten-sive Landwirtschaft, den modernen Häuserbau und die geordneten Betriebe abgelauscht haben, können sie für Palästina dasselbe unternehmen, was die Juden heute mit unsagbaren Opfern begonnen haben. Und dann ist niemand mehr imstande, neben den Arabern aufzukommen. Viele Juden, in Palästina und anders-wo in der Welt, werden wohl ironisch zu solchen Betrachtungen lächeln, aber es gibt auch viele andere hier im Lande und überall, die weniger selbstsicher sind und die genau so denken wie ich. Es ist gefährlich, von den Arabern eine zu geringe Meinung zu haben, wie es immer falsch und gefährlich ist, seine Nebenmenschen zu unterschätzen. Die Gewohnheit, andere zu unterschätzen, war jedesmal noch das Vorzeichen einer Niederlage. Die Araber sind nicht so träge, wie gern behauptet wird und wenn nun der jüdische Fleiß als Sporn in ihrer Flanke sitzt, wenn die Agitation, die von so vielen Seiten so lebhaft betrieben wird, sie aufstachelt, werden sie sich ganz gewiß eines Tages zusammenraffen, und dann werden sie im {273} wirtschaftlichen Kampf die stärkeren sein. Denn ihre Arbeiter sind nicht organisiert, ihre Taglöhner sind ganz bedürfnislos, haben lange nicht die Ansprüche auf geistige Anregung. Und der Araber wird überall, auf allen Gebieten, alles, was von Menschenhänden hergestellt wird, um die Hälfte billiger leisten. Daran müssen die Juden denken, die heute in der ganzen Welt zu glauben scheinen: es hat noch gute Weile mit dem Aufbauwerk.
Das Paradoxe daran ist ja, daß dieses Werk nicht genug überstürzt werden kann und daß dennoch erst die nächste Generation eine Entscheidung zu ge-wärtigen hat. Entschieden aber wird die Sache erst sein, wenn die Kinder, die jetzt aufwachsen, die jetzt in der Wiege liegen oder geboren werden, wenn diese Kinder im Lande bleiben und wenn sie Bauern bleiben. Palästina kann unmöglich für die Dauer, für unabseh-bare Zeit immer nur das Land sein, in das europa-müde, amerikamüde oder begeisterte junge Leute ein-wandern. Damit käme nie eine ruhige, naive, boden-ständige Volksschicht zustande, das wäre kein Aufbau. Ohne eine wirkliche Menschenernte wäre aller Ernte-segen des gelobten Landes nur Spreu.
Die jungen Menschen, die jetzt hier sind, dann die jungen Menschen, die täglich ankommen, haben die Mühsal des Anfangs. Sie sind Emigranten, das darf man nicht vergessen. Und sie sind Eingewanderte, das muß man bedenken. Vorhut sind sie, die sich dar-bringen. Sie sind Aussaat und Keim, hier in die Erde gesenkt, damit Ernte erstehe. Sie sind das kostbarste {274} Kapital, worüber das Judentum verfügt. Und sie wer-den Ernte tragen, mit Gottes Hilfe!
Lächelst du über solchen Ausruf, Jüngling mit dem Voltaire-Gesicht zu Ain Charot? Laß dich das Wort nicht anfechten. Und seid nachsichtig mit mir, ihr jungen Leute alle, in Ain Charot, in Tel Josef, in Beth Alpha, ihr jungen Men-schen am Ufer des Tiberiassees und überall im Land. Ich denke an euch, hier in dieser stillen, schönen Stunde, den Blick aufs Meer gerichtet, das sich tiefer im Purpur der scheidenden Sonne färbt. Und ich be-wundere die reine Kraft, mit der ihr euch hingebt, ich bewundere die Zartheit, die ihr im Umgang mit euren Gefährtinnen, mögen sie nun hübsch oder häßlich sein, an den Tag legt. Ich liebe eure Ideale, euer Ge-fühl für soziales Recht, euer schönes, freies, kühnes Rebellentum. Auch das gegen Gott. Bei uns Juden hat Gottes Widersacher immer seinen Rang und seinen Wert gehabt, er trägt Gott in seinem Herzen und ringt mit ihm,... um ihn.
Auch ihr tragt einen Gott in euerem Innern, wenn ihr gleich nichts davon wißt oder wissen wollt, und ob ihr ihn auch anders nennt, als Gott. Was hätte euch sonst hergeführt, nach Palästina, und was hielte euch da, wo nichts euer wartet, als Mühsal, Plage und frühes Verbrauchtwerden in einem Leben, das härter ist, als überall anderswo auf Erden. Ihr habt Religion in euch, wenn ihr sie auch nicht kennt. Noch niemand kennt sie, diese neue Religion. Aber, es wird eine jüdische Religion sein und es mag geschehen, daß diese altgewordene Welt wieder durch sie erlöst wird.
{275} Mir jedoch sei es erlaubt, mein Genügen zu haben an den wunderbaren Ereignissen der Bibel und an ihren Voraussagungen, die überwältigend sind bis zum heutigen Tag. Es steht geschrieben: 'Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere." Noch ehe das Juden-volk in das Land der Verheißung kam, in der Wüste noch hat Moses gesprochen: 'Dazu wirst du unter den-selben Völkern kein bleibendes Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir daselbst ein bebendes Herz geben und ver-schmachtete Augen und eine verdorrte Seele, daß dein Leben wird vor dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst!"
Wie Donner rollen diese mächtigen Worte aus der Tiefe von Jahrtausenden nun über mich hin. Sie hat sich erfüllt bis ins Letzte, die furchtbare Weissagung. Alles hat sich erfüllt, was Moses gesprochen hat, der gewaltigste Mensch, der je über diese Erde schritt. Sah er das Schicksal dieses Volkes voraus, das er aus Ägyptens Knechtschaft ins gelobte Land heimführte? Hat sein ungeheurer Geist dies ungeheure Schicksal über Jahrtausende weg vor sich gesehen? Er wußte, daß Gott nicht ewig zürne. Und er hat es gewußt, der Göttliche, daß dieses Volk sein Land immer wieder verliert, und daß es immer wieder heimkehrt in sein Land.
{276} Die Sonne ist untergegangen, die Dämmerung ist er-loschen und ich kann das Meer, das nachtdunkel vor mir rauscht, so wenig sehen, wie ich in die Zukunft blicken kann. Was bin ich? Ein nichtiges, winziges Menschenleben, das rasch vergeht und das zufrieden sein muß, die Zukunft rauschen zu hören, ohne sie je zu erblicken.
Seid gesegnet, ihr neuen Menschen auf der alten Erde. Du, Jugend, die den Boden von Palästina be-baut, asiatischen Boden. Du, Jugend, die sich opfert, um das Ideal zu verwirklichen, das in deinem Busen lebt.
Asien ist immer der Boden gewesen, auf dem ein Gott zur Welt kam, wie Europa immer der Boden bleibt, auf dem er entstellt wurde, blaß und sich selber fremd.
